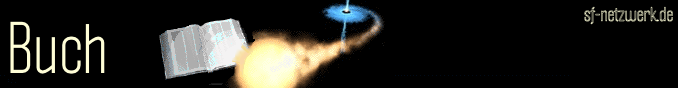Ich erzähle am besten vielleicht einfach mal, wie es mir mit diesem Roman ging.
Als ich damit anfing, war ich überzeugt, eine Geschichte zu schreiben, die im Wesentlichen von technischer Hybris handelte. Die Ausgangssituation war eine typische „was wäre wenn?"-Frage; ich hatte ein klassisches SF-Motiv - den Cyborg -, dem ich durch eine veränderte Sichtweise einen frischen Dreh abzugewinnen hoffte; es gab vage Informationen über Experimente, die in den Sechzigern tatsächlich stattgefunden hatten (in sehr bescheidenem Umfang) und eine Menge Literatur über tollkühne Vorhaben tollkühner Wissenschaftler, Nachfahren Frankensteins, die sich dessen nicht bewußt zu sein schienen… Kurzum, als ich anfing, war mir alles klar.

Bloß ging es irgendwann nicht mehr so voran, wie ich es geplant hatte. Als ich den Anfang hinter mir hatte, fiel es mir immer schwerer, weiterzuschreiben. Ich merkte, dass ich mich regelrecht drückte vor dem Moment, in dem ich mich an den Schreibtisch setzte und das Schreibprogramm aufrief. Dass dieser Moment jeden Tag ein bißchen später kam.
Das kommt vor, und es gibt verschiedene Ursachen dafür, dass einem ein Roman nicht so recht von der Hand will. Die häufigste ist die, dass man nicht genau weiß, wie die Handlung weitergehen soll - logisch, dass es dann stockt. Aber das war nicht der Fall; ich hatte die Handlung im Gegenteil schon in für mich eher unüblicher Detailliertheit ausgearbeitet. (Der Grund dafür war übrigens, dass ich die im Roman nicht beschriebene, sondern weitgehend nur zu erahnende Hintergrundhandlung - wie Reilly von den Vorfällen in Dingle Kenntnis erhält, wann welche Entscheidungen fallen, wann Agenten in Marsch gesetzt werden usw. - genau ausarbeiten und dabei die Zeitverschiebung zwischen Irland, Washington D.C. und Kalifornien einberechnen musste!) Was also war dann los?

Das fragte ich mich,
bis ich begriff, dass ich in Wirklichkeit eine Geschichte über das Altern schrieb. Mein innerer Widerstand kam daher, dass ich mich der Herausforderung, die dieses Buch für mich bedeutete, noch nicht wirklich gestellt hatte: Nämlich mir darüber klar zu werden, dass die Probleme, mit denen Duane sich herumplagt, keine rein auf Cyborgsoldaten beschränkte Probleme sind, sondern dass sie nur in krasserer Form zusammenraffen, was auf uns alle wartet: Der Körper spielt nicht mehr so mit, wie wir das einst gewohnt waren; alles wird langsam anstrengender; körperliche Fähigkeiten versagen, und wir wissen, sie werden nicht wiederkommen. Nie mehr. Das Altern ist eine mehr oder minder schiefe Ebene auf den Tod zu. Und ich musste mir eingestehen, dass ich diese Tatsache bis dahin auch weitgehend erfolgreich verdrängt hatte. Obwohl ich nun auch schon nicht mehr der Jüngste war und den Spruch
"Wenn man über vierzig ist, morgens aufwacht und einem nichts weh tut, ist man tot" als durchaus zutreffend kennengelernt hatte. Justament in der Zeit, in der ich den „Letzten seiner Art" schrieb, hatten beispielsweise meine Augen spürbar nachgelassen; auf einmal musste ich die Brille abnehmen zum Lesen! Von anderen Zipperlein ganz zu schweigen.

Nachdem mir das klar geworden war, konnte ich weiterschreiben. Es war zwar immer noch anstrengend, manchmal beinahe schmerzhaft, aber es ging wenigstens wieder weiter. Aufs Ganze gesehen ist mir wohl kein Roman so schwer gefallen wie „Der Letzte seiner Art", und keinen anderen habe ich so oft und so tiefgreifend überarbeitet. Vom Zeitaufwand her habe ich daran länger gearbeitet als beispielsweise an dem wesentlich umfangreicheren „Quest".

Interessanterweise - ich erwähne das, ohne damit irgendeinen Vorwurf zu verbinden - habe ich anläßlich von Lesungen und anderen Gelegenheiten, bei denen ich Feedback bekam, beobachtet, dass diese Bedeutungsebene der Geschichte von Nicht-SF-Lesern eher gesehen wird als von SF-Lesern. Letztere bleiben leichter an dem vordergründigen technischen Firlefanz hängen, und ich vermute jetzt einfach mal frech, das hängt damit zusammen, dass man leider in vielen SF-Romanen hinter dem technischen Firlefanz tatsächlich nichts oder jedenfalls nichts Wesentliches findet.
Anbei bemerkt birgt jeder Roman, den man schreibt, derartige Herausforderungen in sich, die man vorher oft nicht einmal erahnt. Man kann keinen Roman schreiben (außer natürlich, man weicht aus und bleibt im sicheren Bereich belanglosen Hin- und Her-Handelns), ohne sich selbst dabei zu verändern. Was, wie ich glaube, der eigentliche Grund ist, warum viele Romane angefangen, aber nur wenige beendet werden. Es ist nicht der Zeitaufwand - der ist nicht so schrecklich hoch. Es ist auch nicht das Durchhaltevermögen - viele Leute stehen ganz andere Dinge durch, Marathonläufe etwa. Die meisten Romane kommen an dem Punkt zum Stillstand, an dem sie anfangen, ihren Autor in Frage zu stellen; wenn sie eine Wahrheit ans Licht zu bringen drohen, die man eigentlich lieber nicht wissen möchte.