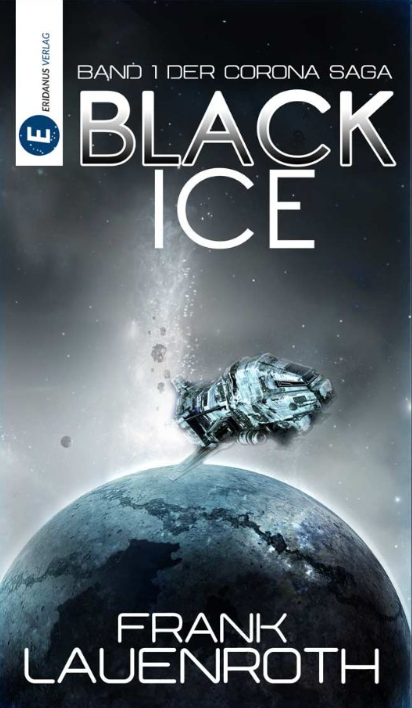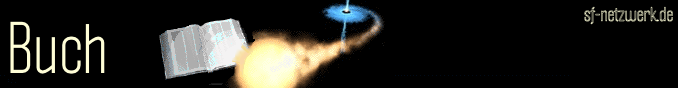Bitte beachten: Wer den Roman für den Kurt-Laßwitz-Preis nominieren will – so wie ich –, sollte wissen, dass es sich dabei um eine Neuauflage aus dem Jahr 2014 handelt. Andernfalls wird man sich dort zum uninformierten Deppen machen – so wie ich.
Wie dem auch sei:
Klischees sind im Regelfall ein Symptom: Sobald genug davon auftauchen, weiß man eigentlich, dass man sich in einem bestenfalls mittelmäßigen Werk befindet. Die Handlung wird sich wahrscheinlich nicht mehr aus dem gewohnten Rahmen bewegen und die überraschende Wendung gewiss nicht überraschen. Wer sich Klischees bedient, muss wissen, was er tut oder sie gekonnt mit Albernheiten und korrekt appliziertem Lampshade Hanging umschiffen. Frank Lauenroth, so seltsam es klingen mag, gelang exakt das – nicht immer, nicht in jeder Szene, aber überraschend gut.
„Black Ice“ startet auf gewohnten Pfaden. Frankie, der Skipper des gealterten Raumschiffes Corona, bemerkt eines Tages, dass er einen blinden Passagier an Bord hat – der mehr zu sein scheint, als einfach nur auf der Suche nach einem neuen Wohnort. Und weil Frank Lauenroth auf seinen Kitchen Sink Approach besteht, kommen dann auch noch bedenkliche Mengen der namensgebenden Droge Black Ice dazu, die sich Laderaum finden.
Wer sich jetzt an „Firefly“, „Skydoll“ oder „The Callisto Protocoll“ erinnert fühlt, der hat vermutlich Recht: Lauenroth bedient sich bei allen dreien (besonders der blinde Passagier Holly teilt sich viele Eigenschaften mit Barbuccis Androidin Noa), interpretiert sie aber sehr schön weiter. Der Roman liefert zudem dafür den sympathischen Protagonisten, der bei Callisto einfach mal komplett fehlte (und mir die Handlung kaputt machte).
Die aus diesem Setup gewohnten Komplikationen aus bösartigen Machthabenden, Super-Corporations und dergleichen folgen bald und der gewohnte Roster an Charakteren, wie man sie aus den Serien oder guten Rollenspielgruppen kennt, schließt sich Frankie an – und erzählt sich wie eine menschliche Zweckgemeinschaft bis hin zu Freunden. Nur den rechtschaffen-bösen Zauberer habe ich vermisst. Weiß Frank Lauenroth nicht, dass jede funktionale Heldentruppe ihren rechtschaffen-bösen Söldner, Ex-General oder Auftragsmörder benötigt? So als Kontrastmittel, Befürworter „notwendiger Entscheidungen“ und insgeheim beliebteste Rolle? Als Ausgleich erhält man dafür die überaus sympathisch entworfene Gostoe – die charmant mit Waifu Vibes der 2000er glänzt. Die Antagonisten funktionieren als solche, agieren aber eher als Antrieb denn Sympathieträger. Hier hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht.
Die allerdings größte Stärke von „Black Ice“ ist, sich seiner selbst bewusst zu sein. Der Roman weiß, dass er kein tiefgehender Thriller oder philosophische Abhandlung sein möchte, ebenso, dass er nicht als reiner Schenkelklopfer wahrgenommen wird – und geht dabei in Kurvenlagen, die er weder als Thriller noch Slapstick könnte. Was funktioniert! Die Klischees, die mich zuerst noch skeptisch machten, wandeln ab etwa Seite 30 zu gut ausgewählten Zutaten. Was ich zunächst noch für eine literarische Fertigpizza hielt, schmeckte bald schon wie einer dieser wirklich guten Burger, die man auf Grillfeiern serviert bekommt: Kalorienhaltiges Schnellfressen, aber mit Qualität.
Denn genau das ist Frank Lauenroths Werk: Überaus leichtgängig und genießbar gut geschrieben. Mich würde nicht erstaunen, wenn viele Leser diese Neuauflage in ein, zwei Tagen durchlesen. Ein guter Snack, der Spaß macht, unterhält, nie stockt und mich entlässt, bevor er anfängt, langweilig oder gleichförmig zu werden. Ein Groschenroman, der zu gut ist, um als einer durchzugehen. Als weiteren Pluspunkt möchte ich anmerken, dass Lauenroth vollständig auf den Tanz über Eierschalen verzichtet, denn ich aktuell bei einigen modernen Werken nicht mehr ertragen kann. Daher auch meine Nominierung.
Meine größte Kritik gilt dem Cover, denn das ist eine glatte Themaverfehlung: Handwerklich bezaubernd und zudem mit gekonnter Farbwahl entworfen, postuliert es Schwermütigkeit und Kälte; leichtfüßig und spaßig ist hingegen der Roman. Und auch wenn mir das Cover von z.B. „Walpar Tonraffir und der Zeigefinger Gottes“ etwas zu schlicht und skizzenhaft war (die Neuauflage entwerfe ich, und wenn ich mich dafür mit Uwe Post prügeln muss), so wäre eines in diesem Stil deutlich besser für Black Ice geeignet gewesen – mit Charakteren statt Karat, wenn man mir hierbei folgen kann.
Als jemand, der das Buch aufgrund des Autorennamens gekauft hat, ohne den Klappentext zu lesen, wurde ich vom Kontrast von Bild zu Roman überrascht – zwar im Positiven, aber manch einer könnte anhand des Einbands eine Geschichte erwarten, die das All als einen kalten, gnadenlosen Ort beschreibt, bevor er sich stattdessen in einer netten Mischung aus "Firefly" und "The Amazing Digital Circus" wiederfindet. Und nein, das war kein Spoiler ;-)
Was ich dafür positiv hervorheben will, ist die Funktionalität von „Black Ice“ – und hier gerate ich an einen spannenden Widerspruch: Was Handlungsstränge angeht, so wende ich gerne ein Prinzip an, dass ich schlicht die „Rollenspielgruppe“ nenne, also eine Gruppe aus vier oder fünf aggressiven, autistisch intelligenten Powergamern und -innen (wie ich sie alle zwei Wochen am Spieltisch sitzen habe). Dabei stelle ich mir vor, wie sie sich in Form einer Pen & Paper-Kampagne durch die Handlung hindurchschlagen müssten. Nicht nur überlege ich dabei, welche Tricks, Waffen und Ausrüstung sie dafür improvisieren werden, sondern auch welche Logiklücken sie aufzeigen oder für ihre eigenen Zwecke ausnutzen würden. Noch heute darf ich mir bspw. anhören, dass ich vor vier Jahren das Einkommen eines Schreibers im Mittelalter um Faktor Drei falsch recherchiert hatte. Gute Rollenspieler sind schlimmer als Fangschreckenkrebse.
Nur die wenigsten Romanwelten und -szenarios deutscher Autoren bestehen aus meiner Sicht diesen Test, die meisten verschlägt es auf eine 0,75 auf der Henderson-Skala. "Black Ice" allerdings nicht. Hierbei muss ich anmerken, dass sich das gesamte Setting durch vor allem seine Geradlinigkeit definiert ("Black Ice" führt nicht in Myst-artige Untiefen), weshalb vielleicht seine Bausteine so korrekt fallen. Das ist nicht für einen guten Roman essentiell, aber ein schöner Pluspunkt.
Frank Lauenroth hat sich wiedermal bewiesen. Dieses Mal aus einer ganz anderen Richtung.
(Falls ich hier zu sehr gespoilert haben sollte, sagt mir bitte Bescheid. Man kann "Black Ice" nicht rezensieren, ohne nicht ein bisschen der Handlung vorwegzunehmen)
Bearbeitet von Maxmilian Wust, 31 Januar 2026 - 10:49.