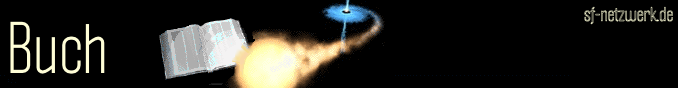Einer meiner Dozenten, damals noch in Studienjahren, sagte mal einen Satz, der bis heute in meinem Kopf Breakout (das Videospiel von Steve Wozniak) spielt: "Gute Künstler sind keine guten Kritiker und gute Kritiker sind keine guten Künstler." Ich glaube, den hat er sich abgewandelt von Paul Arden oder Eva Heller geklaut, aber dazu ein andermal.
Dabei bezog er sich jedenfalls nicht darauf, dass Kunstschaffende nicht auch gut kritisieren können (Edgar Allan Poe war meines Wissens nach recht gefürchtet für seine Kritiken), sondern dass sie auf ganz andere Elemente achten, als der durchschnittliche Konsument. Gehe ich an einem Achtzehneintel am Bahnhof vorbei, fallen mir ganz andere Dinge auf, als den Leuten, die täglich auf dem Arbeitsweg daran vorbeiziehen. Genauso steht es mit Flyern, Plakaten, Comics oder Mangas. Ich sehe da Lösungen für Probleme, die ich selbst oft im Berufsalltag habe; Tricks, die ich mir dreist klauen kann oder Fehler, die mir selbst schon unterlaufen sind. Ein Passant hingegen wird sich beim McFit-Neujahrsvorsätze-Angebot keinen Gedanken darum machen, dass ein Grain-Filter im Hintergrund eine Zerstufung (Kunstwort für Farbbrüche) des Verlaufs verhindert hat, die oft bei einem Farbverlust von über 20% eintritt. Korrigiere: Er wird nicht einmal wissen, dass es das tut. Oder was man als ein Achtzehneintel bezeichnet.
Bei Autoren versus die Werke der anderen sehe ich es sogar noch drastischer: Autoren wünschen sich oft Verbesserungen, die entweder ihrem politischen Gusto entsprechen (ganz prominent: keine oder mehr Progressivität), achten auf Formulierungen, die einem S-Bahn-Leser überhaupt nicht auffallen oder vergleichen die Geschichte mit dem Fundus von Stories, die sie selbst bereits kennen. Und ja, die Kritik kann ich gleich direkt an mich selbst weitergeben: Ich habe mir schon diverse Geschichten selbst kaputt geredet, weil ich als Autor oder Redakteur an sie gegangen bin, statt als einfach nur Konsument.
Bestes Beispiel für einen Design-Autoren ist für mich Joshua Tree. (Falls du das hier liest, Joshua, ist keine Kritik. Aber du könntest uns mal in deinem Roman-Thread antworten ;-) ). Tree verzichtet im Regelfall auf rekursive Elemente, Meta-Ebenen, Symbolik oder ausgefallene Formulierungen und kann, wie es scheint, ziemlich gut davon leben. Ja sogar mein Schwager liest seine Werke – ohne dass ich darauf aufmerksam machen musste. Als ich ihm dagegen Sven Haupt empfohlen habe, meinte er: "Joa, bin 150 Seiten im Roman und es geht immer noch nicht los. Passiert da noch irgendwas?" Da ich kein Freund von Diskussionen über Geschmack bin (denn genauso gut könnte ich einer Katze Quantenschaum erklären), ließ ich ihn einfach reden. Sein Schlusssatz nagt bis heute an mir: "Sven Haupt ist wohl eher ein Autor, der für Autoren schreibt." Aktuell liest er den Neuesten von Q. Morris.
Das ist übrigens auch, was Designstudenten gleich nach dem Abschluss lernen: Dass man keine Kunst macht, um andere Designer oder Professoren zu beeindrucken, sondern Werbung. Die funktionieren muss.
Bei Herausgebern und Verlegern ist das hingegen ein ganz anderes Paar Schuhe: Gerade Mammut, Christoph Grimm, Marianne Labisch, (sicherlich auch bei Uwe Post, aber bei dem bin ich voreingenommen), merkt man aus meiner Sicht an, dass sie von der Funktionalität einer Geschichte in gewisser Weise abhängig sind und daher eher wie Agenturchefs oder Vorkoster als Kunstschaffende an die Werke der anderen herangehen. Ihre Perspektive ist dann nochmal eine andere.
tl;dr: Ich würde ich sagen, Autoren können durchaus gute Kritiker sein, manchmal halt auch zu gut.
Wo ich tatsächlich einen kritischen Punkt sehe, ist das Kritisieren der eigenen Anthologiegeschwister. So wie manche da um sich schlagen, würde ich gerne warnen, dass der- oder diejenige mit ihnen veröffentlicht wurde. Und jeder Text, absolut jeder, kann so lakonisch zerrissen werden, dass der Verriss mehr Spaß macht, als die Geschichte selbst.