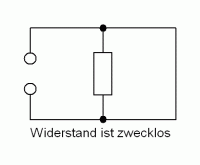Meine Veröffentlichungen: EIN VERANTWORTUNGSLOSER STREICH und DIE ULTIMATE ERFAHRUNG in ALIEN CONTACT DIE ZEIT VON AISST in SOLAR X Kurz vor der Veröffentlichung steht eine Neuausgabe von VÖLKER DER SONNE der 1999 als ALIEN CONTACT-Buch erschienen ist. Online gibt es von mir "Wie das ist" auf http://www.transener...e/sexstory.html (ist allerdings eine Sexstory).@yippie: Du findest eine SF-Story von mir in Nova 7, diverse in der SF-Rubrik auf kurzgeschichten.de sowie auf meiner Homepage upcenter.de.

Was muss sich ändern in der SF?
#121
Geschrieben 22 April 2005 - 09:24
#122
Geschrieben 22 April 2005 - 20:27
Wenn ich dich falsch verstanden habe, rudere ich zurück. (Davon kriegt man zwar einen Knick im Nacken, ähnlich wie beim Konsum dieses Threads, aber das nehme ich dann auf mich.) Vielleicht kannst du mir ja dann die Bedeutung des Zunge-Raushänge-Smileys (Denn im Unterschied zu deiner Zynismusunterstellung war meine Antwort auf das Thema und nicht auf die Person bezogen.
Trotz deines Versuchs diese Diskussion abzuwürgen, stehe ich zu meiner Meinung, daß man bei Tiptree oder auch Brunner beispielhaft sehen kann, wie sozialpolitische Themen in spannenden SF-Geschichten verarbeitet werden können.
Ich versuche den Thread nicht ab zu würgen - es gibt durchaus Leute (wie dich, Beverly, und übrigens auch Pixelprimat) die ich ganz gerne lese. Aber ein gewisser Ton nervt - insbes. wenn er wenig an der persönlichen Meinung zum Thema transportiert. Und deswegen habe ich jetzt nach MEHREREN höflicheren Versuchen, Konrad, einem gewissen anderen Herrn mal etwas klarer meinen Unwillen ausgedrückt. Meine (evtl. verfrühte
/KB
Yay! KI-generiertes SF-Zitat Ende November...
"In the sprawling city forums of the galaxy, where chaos reigns and time flows differently, true power is found not in dominance, but in moderation. The wise use their influence to temper ambition with reason, and chaos with order."
(auf Bing.de generierter Monolog von der Copilot-S/W - die ich hiermit NICHT bewerbe! - nach Aufforderung nach einem "s.f. quote" mit einem bestimmten Wort darin; ich ersetzte nur das 4. Wort mit "city forums")
#123
Geschrieben 22 April 2005 - 21:12
Hast du, Yip, hast du. Aber vielleicht können wir jetzt einen Gang zurückschalten und die Mißverständnisse aufklären.Wenn ich dich falsch verstanden habe, rudere ich zurück. (Davon kriegt man zwar einen Knick im Nacken, ähnlich wie beim Konsum dieses Threads, aber das nehme ich dann auf mich.) Vielleicht kannst du mir ja dann die Bedeutung des Zunge-Raushänge-Smileys (
) nach deiner Wertung Tiptrees (die ich verehre) erklären; vielleicht habe ich dieses Emoticon ja bisher völlig falsch gelesen/benutzt?
Bearbeitet von Konrad, 23 April 2005 - 08:48.
#124
Geschrieben 23 April 2005 - 10:48
(Nach einer PM zum persönlichen Hin-und-Her noch mal etwas sachlicher zu deinem PS...) Ich bin da evtl. zu altmodisch (senil?Ich finde, man sollte "kräftige" Aussagen (wie Diboo's) nicht verdammen, denn sie sind das Salz in der Suppe. Die Zeitverzögerung in der Email-basierten Diskussion ist ein natürlicher Filter, der in den meisten Fällen garantiert, daß die Emotion auch wieder "runter" kommt. Aber wir wollen doch alle eine lebhafte Diskussion im Forum und keine fade Selbstbeweihräucherung, oder ?
Bearbeitet von yiyippeeyippeeyay, 23 April 2005 - 11:10.
/KB
Yay! KI-generiertes SF-Zitat Ende November...
"In the sprawling city forums of the galaxy, where chaos reigns and time flows differently, true power is found not in dominance, but in moderation. The wise use their influence to temper ambition with reason, and chaos with order."
(auf Bing.de generierter Monolog von der Copilot-S/W - die ich hiermit NICHT bewerbe! - nach Aufforderung nach einem "s.f. quote" mit einem bestimmten Wort darin; ich ersetzte nur das 4. Wort mit "city forums")
#125 Gast_Jorge_*
Geschrieben 24 April 2005 - 17:23
Eric Koch`s "CRUPP"-Trilogie bestehend aus: "Die Freizeit-Revoluzzer"(The Leisure Riots) "Die Spanne Leben"(The Last Thing you`d want to know) "Kassandrus"(Cassandrus) Entstanden in den frühen 70ern("Kassandrus" wurde in den 80ern geschrieben), schildern die Romane die Arbeit einer Denkfabrik namens CRUPP(Center for Research on Urban Policy and Planning), geleitet von Friedrich Bierbaum(einem Ex-Nazi und Ex-Assistent Görings; worauf in diesen tiefschwarzen Satiren immer wieder Bezug genommen wird), die sich mit Problemen in einem Amerika der nahen Zukunft befaßt. In "Die Freizeit-Revoluzzer" häufen sich merkwürdige und unerklärliche Vorfälle, bei denen öffentliches und privates Eigentum vorsätzlich beschädigt, Theater und Konzertaufführungen gestört und Freizeiteinrichtungen verwüstet werden. Crupp ermittelt und findet die Urheber der Krawalle: Arbeitslose und Frührentner, deren Arbeitsplätze wegrationalisiert wurden, trotz einigermaßen guter Versorgung aber vor Langeweile umkommen und deren "Armee" immer mehr anwächst... In "Die Spanne Leben" ist das Amerika der nahen Zukunft eine wundergläubige Zeit geworden, in der die wachsende Verdrossenheit an den exakten Naturwissenschaften zu einer überwältigenden Sehnsucht nach dem Übernatürlichen geführt hat: Es herrscht ein Boom für Religion,Astrologen und Sektengründer, "Schwarze Messe"-Parties sind "In" und gesellschaftsfähig; ein Trend, den clevere Geschäftemacher und Politiker auszunutzen wissen... ("Kassandrus" habe ich noch nicht in meiner Sammlung bzw gelesen) Wie man sieht, sind diese "aktuellen" Themen schon früher behandelt worden. Weitere Beispiele wären z.b noch Michael Bishops "Die Jahre in den Katakomben"(religiöser Fundamentalismus) und T.J. Bass "Die Ameisenkultur/Der Gottwal"(Übervölkerung/Umweltzerstörung/Genmanipulation) undund...Die Social Fantasies Alterspyramide Überwindung des Wohlstandsgefälles Globalisierung religiöser Fundamentalismus Gleichberechtigung Erziehung und Bildung Sonst noch Beispiele?
Bearbeitet von Jorge, 24 April 2005 - 17:31.
#126
Geschrieben 24 April 2005 - 18:40
was beweist, dass man doch Zugang finden kann. Ich denke aber, dass aus heutiger Sicht noch einiges dazu zu sagen wäre. Gruß Thomas...Wie man sieht, sind diese "aktuellen" Themen schon früher behandelt worden...
Thomas Sebesta/Neunkirchen/Austria
Blog zur Sekundärliteratur: http://sebesta-seklit.net/
Online-Bibliothek zur Sekundärliteratur: http://www.librarything.de/catalog/t.sebesta
Facebook-Gruppe: https://www.facebook...tik.ge/members/
#127
Geschrieben 25 April 2005 - 11:40
Die "Sdcial Fantasy" ist so alt wie die Science Fiction. So gibt es eine Kurzgeschichte von H. G. Wells, in der ein Angehöriger der Oberschicht für kuzre Zeit den Absturz in die Unterschicht erlebt. Die Armen und Ausgebeuteten leben da in höhlenartigen unterirdischen Siedlungen bzw. den Untergeschossen der glitzernden Hochhäuser der Reichen. Das hat Wells dann in "Die Zeitmaschine" zu den Morlocks und Eloi weiter entwickelt. Die Morlocks sind die vertierten Nachfahren der Unterschicht, die Eloi die verblödeten - den als besonders helle kann man sie nicht bezeichnen - Nachfahren der Oberschicht. Dass die Ex-Unterschicht die Angehörigen der ehemaligen Oberschicht nun als Fleischlieferanten hält, kann man als makabere Umsetzung von Hegels Dialektik von Herr und Knecht ansehen. Meines Wissens landen in "Eine Handvoll Venus und ehrbare Kaufleute" von Pohl auch ein Angehöriger der Oberschicht für kurze Zeit in der Arbeiterklasse, auf einer Art Trawler. "1984" von Orwell ist DAS Standardwerk einer - dystopischen - Social Fantasy. "Kallocain" von Karin Boxe rechnet ebenfalls mit totalitärem Stalinismus und Faschismus ab. "Ein Rückblick aus dem Jahr 2000" von Bellamy ist ein Beispiel für positive Social Fantasy.Wie man sieht, sind diese "aktuellen" Themen schon früher behandelt worden. Weitere Beispiele wären z.b noch Michael Bishops "Die Jahre in den Katakomben"(religiöser Fundamentalismus) und T.J. Bass "Die Ameisenkultur/Der Gottwal"(Übervölkerung/Umweltzerstörung/Genmanipulation) undund...
#128
Geschrieben 25 April 2005 - 11:45
#129
Geschrieben 25 April 2005 - 12:07
Das bestreitet ja auch keiner, nur sind diese Beispiele doch wohl ein bisschen "veraltet" um sie in einer Dikussion über die jetzigen Verhältnisse anzuführen 1984 erschien glaube ich 1949 Kallocain 1940 Zeitmaschine 1895 Eine Handvoll Venus und ehrbare Kaufleute - Anfang der 50iger (1952 oder 1953 glaube ich)Die "Sdcial Fantasy" ist so alt wie die Science Fiction.
den Tipp muss ich mir mal ansehen, danke Gruß ThomasEs gibt sogar eine Buchreihe, die sich dem Thema widmet: http://www.socialfantasies.de/
Bearbeitet von t.sebesta, 25 April 2005 - 12:08.
Thomas Sebesta/Neunkirchen/Austria
Blog zur Sekundärliteratur: http://sebesta-seklit.net/
Online-Bibliothek zur Sekundärliteratur: http://www.librarything.de/catalog/t.sebesta
Facebook-Gruppe: https://www.facebook...tik.ge/members/
#130
Geschrieben 25 April 2005 - 12:22
Aktuelle Bücher zum Thema "Social Fantasy" sind mir auch keine bekannt, sie scheinen im Moment sehr unpopulär zu sein...
Ah, ein Buch habe ich doch: "The Chronoliths" von Robert Charles Wilson (erscheint in Kürze auf deutsch), solltet ihr euch schon mal vormerken. Ich habe eine Rezi auf dem SF-Board veröffentlicht.
Sullivan
#131
Geschrieben 25 April 2005 - 12:22
Bearbeitet von Uwe Post, 25 April 2005 - 12:23.
Herausgeber Future Fiction Magazine (deutsche Ausgabe) ||| Aktuelles Buch: KI - KOMISCHE INTELLIGENZ (mit Uwe Hermann) ||| edition-übermorgen.de ||| uwepost.de ||| deutsche-science-fiction.de
#132
Geschrieben 25 April 2005 - 12:28
äh, ja das stimmt - so gehts leicht - danke für den TippKleine Korrektur: 1984 erschien...1948, leicht zu merken.
Tja, und da orte ich auch das Problemchen damit - die heutige Zeit ist zu schnelllebig und ich könnte mir denken, dass sich Autoren davon abschrecken lassen, in schon drei oder fünf Jahren als widerlegt zu gelten. - Aber ist es so wichtig recht zu haben. jedes Werk dokumentiert eine Haltung aus seiner Entstehungszeit heraus (aber wer berücksichtigt das schon beim Lesen?).Jedenfalls stimme ich Thomas zu: So interessant auch die genannten Social Fantasies sind - sie sind Kinder ihrer Zeit, und wir leben heute in einer anderen.
Gruß
Thomas
Bearbeitet von t.sebesta, 25 April 2005 - 12:31.
Thomas Sebesta/Neunkirchen/Austria
Blog zur Sekundärliteratur: http://sebesta-seklit.net/
Online-Bibliothek zur Sekundärliteratur: http://www.librarything.de/catalog/t.sebesta
Facebook-Gruppe: https://www.facebook...tik.ge/members/
#133 Gast_Jorge_*
Geschrieben 25 April 2005 - 18:30
Zum Vergleich dazu zwei Zitate von früher: "Was die heutige Science Fiction angeht, so ist Aldiss skeptisch. Das Genre sei etwas heruntergekommen, meint er. In den Frühzeiten sei SF noch etwas besonderes gewesen, sie habe ein verständiges, kenntnisreiches und interessiertes Publikum gehabt, einen regen Austausch zwischen Lesern und Autoren. In diesem begrenzten Rahmen sei so etwas wie eine immerwährende Diskussion abgelaufen, eine beständige Weitergabe von Ideen, und das habe viele gute Stories, viele ausgezeichnete Romane hervorgebracht. Doch als die SF dann den Sprung in die Massenliteratur schaffte, da habe man das ganze vereinfachen müssen. Leser, die über den "Krieg der Sterne" oder "E.T." zur Science Fiction gekommen seien, brauchten leichtverdauliche Kost, simple Fakten, einfache Handlungen. Bücher, die wirklich umwälzende Ideen enthielten, die den Leser zum Nachdenken bringen wollten, seien für dieses Publikum nicht das richtige Lesefutter. Solche Leser und die Autoren, die für sie schreiben, sind dann -so Aldiss- wohl auch der Grund, weshalb SF als Literatur in den vergangenen Jahren sehr viel weniger aufregend oder anregend geworden ist. Science Fiction als Literatur über die Zukunft? Aldiss schüttelt den Kopf: "Ich glaube, daß die Zukunft nur als Spiegel benutzt wird, um die guten oder bösen Entwicklungen der Gegenwart zu reflektieren, sie deutlicher ins Bewußtsein zu heben." Und die Zukunft der Science Fiction? Hier kann er sich ein Lächeln nicht verkneifen. Die Rolle des Propheten liegt ihm - und so schlecht ist er darin gar nicht. 1970 bereits hatte er die Erwartung geäußert, daß die akademisch Gebildeten sie für sich entdecken - und das ist auch innerhalb von nur zehn Jahren eingetreten. Für die Zukunft erwartet er eine weitere Differenzierung des Angebots: auf der einen Seite intellektueller Bücher, geschrieben vielleicht für eine Minderheit, die an echter SF, an "hardcore science fiction" interessiert ist. Und auf der anderen Seite Romane, die für die Leute gedacht sind, die sich von E.T. zu Begeisterungsstürmen hinreißen ließen. Bücher für das rasche Geschäft, sozusagen. So schief dürfte er damit nicht liegen. In den USA, Großbritannien und der Bundesrepublik haben die Medienkonzerne die Ware Science Fiction längst für sich entdeckt. Und bei so manchem, was unter dem Etikett SF vermarktet wird, kann es einen gelegentlich nur noch grausen..." aus "Hat die Science Fiction Zukunft?" SF-Star 11/12 Nov./Dez. 1983 "Das Literaturgenre des Phantastischen wird zusehends langweiliger: Auf dem scheinbar für alles aufnahmebereiten Büchermarkt der Bundesrepublik erscheinen immer mehr Titel, doch der boomartige Zuwachs hat nicht unbedingt zu einer Vermehrung der in diesem Genre grundsätzlich raren Qualitäten geführt. Allmählich scheint den Autoren und Verlagen das eigentliche der Phantastik aus dem Blick zu geraten, den meisten Schreibern fehlt das Bewußtsein um deren subversive Elemente. Bizzarerie und Befremdlichkeit ersetzen immer mehr das Subversive, die möglichst ironische Unterminierung der erwartbaren, durch die aufgeklärte Vernunft scheinbar so zementierten Wirklichkeit fehlt der um der Allgemeinverständlich- und Absetzbarkeit willen domestizierten Phantastik. Zu ihrem Schaden. "Ich glaube, daß jegliche Horror-Fiktion allegorisch zu verstehen ist. Die verborgensten Ängste einer Gesellschaft kommen in den Horror-Romanen in Form von Alpträumen ans Licht." Das stammt von Stephen King -der es wie kein zweiter wissen muß- und läßt sich sinngemäß durchaus auch auf die anderen Gebiete der gedruckten Phantastik anwenden. Was aber bekommt der Leser anstelle der Allegorien kollektiver Alpträume? Mit Weltraumkriegen (noch immer), dümmlichen Endzeitszenarios, E.T.s oder pseudosoziologischer Wahrsagerei(besonders bei uns) verseuchte SF, Fantasy im Stile der reichlich überschätzten Michael Ende oder Hans Bemmann, die den guten alten Bildungs- und Eriehungsroman nur ein wenig aufpoliert haben, und Horror, der angesichts von John Sinclair oder der Blutrunstwelle im Kino jedweden Anspruch -und das auf längere Zeit- verloren hat. Die literarische Subversion aber, in Form negativer und positiver Utopien oder als Zerrspiegel einer Realität, die selbst schon phantastische Züge trägt, gibt es nur gelegentlich noch." aus "Die Furie des Vergessens - Die Visionen der Brüder Strugatzki" SF-Star 11/12 Nov./Dez. 1983 Wie man sieht, ist die Thematik nicht neu, aber nicht unberechtigt: Auch beim heutigen Angebot kann einen bei manchem nur noch grausenDie heute erscheinende Science Fiction entlockt selbst eingefleischten Fans oft nur ein müdes Gähnen. Die Kritik macht sich an folgenden Punkten fest: Die Bücher sind zu dick, eine nur für 200, 300 Seiten taugende Handlung wird auf 600 oder 700 Seiten aufgeblasen Die x-te Space-Opera nach Schema F mit fiktiven Technologien, welche die SF schon vor 60 oder 70 Jahren beherrschte (Raumschiffe etc.). "Weltraum" ist zudem trotz stagnativer Tendenzen in der Raumfahrt auf dem besten Wege, Realität zu werden, man denke nur an die Entdeckung von immer mehr extrasolaren Planeten. Hier hat die Wirklichkeit die SF längst eingeholt. Ich selbst kann hinzufügen, dass ich Bücher über das 21. Jahrhundert, "nahe Zukunft" nur in Ausnahmefällen lese. Zum einen hat das John Brunner schon vor 30 Jahren treffend abgehandelt - "Morgenwelt", "Schafe blicken auf". Ferner ist diese Literatur ziemlich deprimierend und wir leben doch in der von ihr beschriebenen Welt (es wäre daher eigentlich Gegenwartsliteratur) Eine Zufallsbegegnung sagte bezüglich SF mal "das ist alles so finster und deprimierend". Stimmt, wenn man an die Szenarien in "Outland", den "Alien-Filmen" oder den Romanen von Alastair Reynolds denkt. Aber m. E. gibt es auch Licht am Ende des Tunnels: So durchgeknallte Weltentwürfe wie in "Lord Gamma" von Michael Marrak oder die Taschenuniversa in dem Zyklus von Philipp José Farmer. Mehr davon! Mehr abgedrehte Ideen.
#134
Geschrieben 26 April 2005 - 16:17
*unterschreib* Das gilt auch heute, obwohl es rühmliche Ausnahmen gibt...Die literarische Subversion aber, in Form negativer und positiver Utopien oder als Zerrspiegel einer Realität, die selbst schon phantastische Züge trägt, gibt es nur gelegentlich noch.
Herausgeber Future Fiction Magazine (deutsche Ausgabe) ||| Aktuelles Buch: KI - KOMISCHE INTELLIGENZ (mit Uwe Hermann) ||| edition-übermorgen.de ||| uwepost.de ||| deutsche-science-fiction.de
#135
Geschrieben 26 April 2005 - 18:41
MOLOSOVSKY IST DERZEIT IN DIESEM FORUM NICHT AKTIV: STAND 13. JANUAR 2013.
Ich weiß es im Moment schlicht nicht besser.
#136
Geschrieben 26 April 2005 - 18:43
Herausgeber Future Fiction Magazine (deutsche Ausgabe) ||| Aktuelles Buch: KI - KOMISCHE INTELLIGENZ (mit Uwe Hermann) ||| edition-übermorgen.de ||| uwepost.de ||| deutsche-science-fiction.de
#137
Geschrieben 26 April 2005 - 20:12
Bearbeitet von molosovsky, 26 April 2005 - 20:24.
MOLOSOVSKY IST DERZEIT IN DIESEM FORUM NICHT AKTIV: STAND 13. JANUAR 2013.
Ich weiß es im Moment schlicht nicht besser.
#138
Geschrieben 26 April 2005 - 20:46
Bei mir kommt dazu, dass ich ein Problem mit "Modewellen" habe. Ich frage mich, wie viele herausragende Werke der SF und Nicht-SF-Literatur erschienen wären, wenn sich ihre Verfasser nach der gerade akuten Mode oder dem Zeitgeist gerichtet hätten. War es eigentlich "hip", über korrupte Adlige zu schreiben, als Schiller "Kabale und Lieber" verfasste? Lag H. G. Wells mit "Die Zeitmaschine" in Trend seiner Zeit oder hat er einen neuen Trend gesettet? Ich sehe vier mögliche Arten der Relation "Zeitgeist-Autor": 1. Der Autor schreibt gegen den Zeitgeist, ist aber schlecht 2. Der Autor schreibt mit dem Zeitgeist, ist aber auch schlecht 3. Der Autor schreibt mit dem Zeitgeist, ist aber gut 4. Der Autor schreibt gegen den Zeitgeist, ist aber gut IMHO haben gute Autoren zumindest von der Logik her immer eine Chance: schreiben sie mit dem Zeitgeist, stehen ihnen Türen offen, weil es das ist, was viele Leute lesen wollen und womit sie sich identifizieren. Schreiben sie gegen den Zeitgeist, fallen sie bei denen auf fruchtbaren Boden, denen der gerade akute Zeitgeist auf die Nerven geht. So waren die Hippies eine Gegebewegung gegen die Spießer, der Punk eine Gegenbewegung gegen die Hippies usw.»Die *Modewelle* der Sozial SF ist vorbei.« Halte ich für eine voreilige Aussage.
#139
Geschrieben 01 Mai 2005 - 03:35
Ich möchte nochmal Thomas' Stichwort "Unterhaltungsgenre" aufgreifen und die provokante Frage stellen: Wird das SF-Genre von Fluchtliteratur dominiert, nachdem im Zeichen von TUI der Reiseroman für diesen Zweck ausgedient hat ? Ist dieses Genre neben Fantasy sozusagen die letzte Bastion für diesen Literatur-Typus ?Von der Bedrohung durch missglückte Genmanipulationen gar nicht zu sprechen. Man gibt's keine Autoren die diese Themen anpacken? Wo sind die Autoren, die aufzurütteln verstehen um auch Meinungsbilden zu wirken. Lasst die SF nicht zu einem reinen Unterhaltungsgenre verkommen!
#140
Geschrieben 01 Mai 2005 - 09:50
Bearbeitet von Uwe Post, 01 Mai 2005 - 09:51.
Herausgeber Future Fiction Magazine (deutsche Ausgabe) ||| Aktuelles Buch: KI - KOMISCHE INTELLIGENZ (mit Uwe Hermann) ||| edition-übermorgen.de ||| uwepost.de ||| deutsche-science-fiction.de
#141 Gast_Jorge_*
Geschrieben 27 Mai 2013 - 19:52
Wie man sieht, sind diese "aktuellen" Themen schon früher behandelt worden.
wie z.b. hier
Fritz Leiber
"Gute Neue Zeit"(The Good New Days -1965-)
In der Zukunft scheint es zunächst allen Menschen gut zu gehen, doch der Augenschein trügt. In der Demokratie und Freiheit ist der Konkurrenzkampf zwischen den Menschen so groß geworden, dass niemand mehr mit nur einem Job auskommt. Die meisten Leute haben fünf oder sechs Jobs, wer sogar zehn Jobs hat, wird geradezu als Held gefeiert. Selbstbestimmte Freizeit hat niemand mehr, doch man argumentiert sich selbst gegenüber, dass man eigentlich gar keine Freizeit benötigt, da man für die Dinge, die man zum Spaß tun würde, ebenfalls Geld verdienen kann. Im Gegensatz dazu ist die medizinische Versorgung mehr als unzureichend.
-aus-
Hardy Kettlitz / Christian Hoffmann
Fritz Leiber - Schöpfer dunkler Lande und unrühmlicher Helden
Bearbeitet von Jorge, 21 April 2014 - 13:30.
#142
Geschrieben 27 Mai 2013 - 20:24
wie z.b. hier
Fritz Leiber
"Gute Neue Zeit"(The Good New Days -1965-)
In der Zukunft scheint es zunächst allen Menschen gut zu gehen, doch der Augenschein trügt. In der Demokratie und Freiheit ist der Konkurrenzkampf zwischen den Menschen so groß geworden, dass niemand mehr mit nur einem Job auskommt. Die meisten Leute haben fünf oder sechs Jobs, wer sogar zehn Jobs hat, wird geradezu als Held gefeiert. Selbstbestimmte Freizeit hat niemand mehr, doch man argumentiert sich selbst gegenüber, dass man eigentlich gar keine Freizeit benötigt, da man für die Dinge, die man zum Spaß tun würde, ebenfalls Geld verdienen kann. Im Gegensatz dazu ist die medizinische Versorgung mehr als unzureichend.
-aus-
Hardy Kettlitz / Christian Hoffmann
Fritz Leiber - Schöpfer dunkler Lande und unrühmlicher Helden
Das ist doch fast unsere Gegenwart!
Arbeit wird überbewertet.
Da ich eigentlich imemr etwas tue arbeite ich aber trotzdem nicht die ganze Zeit.
Weil diese Tätigkeiten keinem gewissen "Zwang" unterliegen ...
lothar
http://sternenportal.org/
http://slo-faster-graphics.org/
https://bsky.app/pro...ter.bsky.social
https://www.facebook.../lothar.bauer01
-
• (Film) als nächstes geplant: Equi
#143
Geschrieben 13 Juni 2013 - 11:53
Mumpitz. So lange wir nur in unserem Sonnensystem herumkriechen können, wird die SF auf absehbare Zeit nicht überholt sein.
Ja, sehe ich ähnlich. Zumal wir ja noch nicht einmal in unserem eigenen System herumkriechen. Inzwischen ist die Fülle an SF-Romanen derart riesig, dass man kaum die Zeit hat, jedes Buch zu lesen und zu beurteilen. Es ist wie in der Fantasy auch: Viele Ideen sind in die Jahre gekommen und werden ständig neu aufgewärmt. Allerdings gibt es immer wieder neue Ansätze, die interessant sind. Man denke an die "Albae" (Heitz) als Fantasyhelden; das ist eine nette Neuinterpretation, wie ich meine. So etwas kennt der "moderne" SF ja auch.
Bearbeitet von alexandermerow, 13 Juni 2013 - 11:55.
Science-Fiction, Fantasy, Dystopie...alles da! Jetzt neu: Mein Roman "Scanfleisch"
www.alexander-merow.de
- • (Buch) gerade am lesen:Michael Moorcock - Die Saga vom Ende der Zeit
- • (Buch) als nächstes geplant:Markus Heitz - Die Rache der Zwerge
#144 Gast_Jorge_*
Geschrieben 21 April 2014 - 13:48
'Jorge'
Wie man sieht, sind diese "aktuellen" Themen schon früher behandelt worden.
wie z.b. hier
Fritz Leiber
"Gute Neue Zeit"(The Good New Days -1965-)
In der Zukunft scheint es zunächst allen Menschen gut zu gehen, doch der Augenschein trügt. In der Demokratie und Freiheit ist der Konkurrenzkampf zwischen den Menschen so groß geworden, dass niemand mehr mit nur einem Job auskommt. Die meisten Leute haben fünf oder sechs Jobs, wer sogar zehn Jobs hat, wird geradezu als Held gefeiert. Selbstbestimmte Freizeit hat niemand mehr, doch man argumentiert sich selbst gegenüber, dass man eigentlich gar keine Freizeit benötigt, da man für die Dinge, die man zum Spaß tun würde, ebenfalls Geld verdienen kann. Im Gegensatz dazu ist die medizinische Versorgung mehr als unzureichend.
-aus-
Hardy Kettlitz / Christian Hoffmann
Fritz Leiber - Schöpfer dunkler Lande und unrühmlicher Helden
oder hier
Robert Sheckley
"Lebenshaltungskosten" / "Der Preis des Fortschritts"(Cost of Living -1952-)
Mr. Carrin hat in seinem Leben alles, was er braucht: eine Familie, einen Job und vor allem ein voll automatisiertes Zuhause. Er besitzt alle neuesten Gerätschaften, die ihm das Leben erleichtern, und alles stammt vom Marktführer Avignon. Doch diese Geräte haben ihren Preis, so dass Carrin, wie alle seine Nachbarn, immer höhere Kredite aufnehmen muss. Als klar wird, dass er zu seinen eigenen Lebzeiten diese Kredite überhaupt nicht mehr abzahlen kann, überredet ihn der Avignon-Finanzberater schließlich, die ersten dreißig Jahre des Einkommens seines Sohnes Billy zu beleihen. Schließlich wird Billy auch alles erben, das Carrin jetzt besitzt. Und so kauft Carrin weiter und weiter, auch wenn er die ganzen Geräte kaum benutzt und ihm am Ende sogar klar wird, dass er es nicht mag, Knöpfe zu drücken, damit eine Arbeit ausgeführt wird.
Sheckley übt auf sehr anschauliche Weise Kritik an der Konsumgesellschaft und vor allem an der Kreditsklaverei großer Finanzunternehmen. Seine Protagonisten sind in ihren finanziellen Verpflichtungen gefangen und es gibt keinen Ausweg. Der kleine Sohn Billy träumt zwar davon, eines Tages Raumfahrer zu werden, doch ihm wird nichts weiter übrig bleiben, als jeden Tag arbeiten zu gehen, um die finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. An einer Stelle wird erwähnt, dass ein Nachbar Carrins den einzigen Ausweg darin gesehen hat, sich selbst umzubringen. Der einzige Trost, den das Leben noch bietet, ist die Anschaffung neuer Produkte und Geräte, die aber nur für kurze Zeit glücklich machen.
-aus-
Hardy Kettlitz / Christian Hoffmann
Robert Sheckley - Mörderspiele und kosmische Reisen
(S.15 - 16)
#145
Geschrieben 17 Juli 2014 - 11:31
Günter Hack (der berühmte FAZ-Aufsatz "Wir brauchen eine neue SF")
Sandra Newman ("Rambling, offensive - and unbeatable: beam me up, old-school sci fi" im Guardian)
Alles, was mir dazu eingefallen ist, war: "Huh? Was wollen die eigentlich von mir?!" - nicht sonderlich geistreich, aber irgendwie werd ich diese zwei Artikel auch nicht los ...
#146
Geschrieben 17 Juli 2014 - 11:37
#147
Geschrieben 17 Juli 2014 - 12:00
Michael Siefener im Gespräch mit Ralf Steinberg
http://www.fantasyguide.de/13617/
Zitat:
Für mich selbst kommt so etwas nicht in Frage. Ich habe mir durchaus einmal die Frage gestellt, was »der Markt« (dieses ominöse Gebilde, das unser ganzes gegenwärtiges Leben zu durchdringen scheint und schon deshalb ein Topos des Grauens ist) verlangt, aber mir ist irgendwann klar geworden, dass die Bücher, die ich nach »dem Markt« zu schreiben versucht habe, eindeutig meine schlechtesten sind. Daher gibt es für mich nur den einen Weg, das in Worte zu fassen, was mich selbst umtreibt. Wenn es Menschen gibt, die das gern lesen, freue ich mich sehr, aber aufgrund dieser recht individuellen Herangehensweise an die Literatur wird der Kreis der Rezipienten stets sehr begrenzt sein. Wir behaupten zwar, in einer individualistischen Zeit und Gesellschaft zu leben, aber wenn man genauer hinschaut, ist das Gegenteil der Fall. Die Menschen (jedenfalls ihr Äußeres), die Häuser, die Autos – alles wird immer gleichförmiger und auf eine angeblich herrschende Masse berechnet. Mein Mittel gegen die Konformität ist also das Herausholen der Ängste und unheimlichen Vorstellungen aus den Tiefen meines Selbst, ohne dabei auf »Märkte« oder Meinungen zu hören.
Ähnlich hat sich auch Richard Lorenz im Interview bei Frank Duwals dandelion-Blog geäußert:
http://dandelionlite...lockquote' ><p>Tatsächlich glaube ich, man sollte die Geschichten schreiben, die man in sich trägt, und nicht die Geschichten, die das Publikum hören möchte. Gerade durch den neuen Boom des Self-Publishing entsteht jener Eindruck: Schreibe, was sie lesen wollen, und du bist ein gemachter Mann. So etwas ängstigt mich. Denn dann wird es keine innovativen Bücher mehr geben.
#148
Geschrieben 17 Juli 2014 - 12:41
#149
Geschrieben 17 Juli 2014 - 12:56
Gerade SP erlaubt doch auch, ohne Rücksicht auf den Götzen der Vermarktbarkeit zu schreiben, sich Nischen zu suchen und innovativ zu sein.
Hm, findest du, das Angebot als Leser hat sich gebessert und es gibt viele innovative Nischenbücher durch das SP? Hast du mal ein paar lesenswerte Beispiele?
Wenn ich mir die Bestsellerlisten im Bereich Horror auf Amazon anschaue, scheint mir das aus reinen Klonen zu bestehen, die einen vorhandenen Trend ausschlachten. Und gerade im SP Bereich sind mir bisher wenig innovative Nischenbücher über den Weg gelaufen. Aber das kann ja auch an meiner bisherigen Auswahl liegen. Im Kleinverlagsbereich muss man ja auch tief wühlen bis man für sich passendes gefunden hat.
#150
Geschrieben 17 Juli 2014 - 15:45
Ich glaube, Michael Siefener und Richard Lorenz sind zwei Vertreter einer eher seltenen Philosophie des Schreibens und leben diesbezüglich in einer überschaubaren Welt der Bücher und Geschichten - im Vergleich zu dem, was "den Markt" in seiner Gesamtheit betrifft.Gerade SP erlaubt doch auch, ohne Rücksicht auf den Götzen der Vermarktbarkeit zu schreiben, sich Nischen zu suchen und innovativ zu sein.
"Die Größe eines Landes bemisst sich nicht daran, wie es mit den Mächtigen umgeht. Die Größe eines Landes bemisst sich daran, wie es mit den Machtlosen umgeht."
Jorge Ramos
Besucher die dieses Thema lesen: 0
Mitglieder: 0, Gäste: 0, unsichtbare Mitglieder: 0