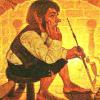Da a3kHH meine Bitte, seine Generalkritik an der Literaturwissenschaft an einem anderen Ort zu platzieren, ignoriert, hier nur eine kurze Zwischenmeldung. Ich werde auf diese nur mässig originellen Einwürfe nicht eingehen und mich nur melden, falls die Diskussion ums eigentliche Thema geht. An die anderen geht meine Bitte, das Gleiche zu tun.Das ist aber eine rein persönliche Sichtweise, die in keinster Art und Weise objektivierbar ist. Ganz davon abgesehen : Ist nicht genau das Gegenteil richtig ? Ich meine, kann man nicht nur Strukturen, die einem nicht gefallen, identifizieren ? Ich weiss zum Beispiel sehr gut, warum ich Thomas Mann ablehne, während ich nur ein diffuses Gefühl dafür habe, warum ich Heinrich Mann gut finde.
Und gerade Heinlein & Dick (zwei meiner Lieblingsautoren) bestätigen das oben geschriebene. Während Dick (für mich) immer lesbar ist, unabhängig von der Periode, in der der Roman geschrieben wurde, habe ich aufgehört Heinlein zu lesen, als seine Dirty-Old-Man-Phase überhand nahm. Wo ist da die "Regel" ?

Phantastik-Begriff
#301
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 11:29
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#302
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 11:53
Ob die Dialoge beim späten Heinlein gegenüber dem frühen Heinlein überhand nehmen, kann man durchaus objektivieren. Wer Lust hätte, könnte es abzählen. Was man quantifizieren kann, ist eo ipso objektivierbar. Wenn Du dasselbe nur gefühlsmäßig zur Kenntnis nehmen, Deine Gefühle aber nicht analysieren und auf ihre objektivierbaren Gründe zurückführen möchtest, ist das Dein gutes Recht. Du solltest aber nicht anderen absprechen, Texte analysieren und ihre Wirkung objektivieren zu wollen. Das ist kein Sakrileg, ist ist legitim.Das ist aber eine rein persönliche Sichtweise, die in keinster Art und Weise objektivierbar ist. Ganz davon abgesehen : Ist nicht genau das Gegenteil richtig ? Ich meine, kann man nicht nur Strukturen, die einem nicht gefallen, identifizieren ? Ich weiss zum Beispiel sehr gut, warum ich Thomas Mann ablehne, während ich nur ein diffuses Gefühl dafür habe, warum ich Heinrich Mann gut finde.
Und gerade Heinlein & Dick (zwei meiner Lieblingsautoren) bestätigen das oben geschriebene. Während Dick (für mich) immer lesbar ist, unabhängig von der Periode, in der der Roman geschrieben wurde, habe ich aufgehört Heinlein zu lesen, als seine Dirty-Old-Man-Phase überhand nahm. Wo ist da die "Regel" ?
Bearbeitet von Klaus Kunze, 31 Dezember 2007 - 11:54.
#303
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 12:16
Vollkommen richtig, die Anzahl der Dialoge kann man abzählen. Aber welche Relevanz hat das ? Kann nicht ein rein dialog-basierter Roman ebenso gut sein wie ein reiner Erzählungs-Text ? Und ist nicht die Wirkung auf einen Leser "absolut subjektiv" ? Diese subjektive Wirkung ist eben nicht objektivierbar, das ist der springende Punkt. Sie ist vielleicht aus einer rein persönlichen Sicht erklärbar, aber schon nicht auf deinen Nebenmann übertragbar. Und selbst die persönliche Sicht ändert sich mit der Zeit, sie ist nicht konstant.Ob die Dialoge beim späten Heinlein gegenüber dem frühen Heinlein überhand nehmen, kann man durchaus objektivieren. Wer Lust hätte, könnte es abzählen. Was man quantifizieren kann, ist eo ipso objektivierbar. Wenn Du dasselbe nur gefühlsmäßig zur Kenntnis nehmen, Deine Gefühle aber nicht analysieren und auf ihre objektivierbaren Gründe zurückführen möchtest, ist das Dein gutes Recht. Du solltest aber nicht anderen absprechen, Texte analysieren und ihre Wirkung objektivieren zu wollen. Das ist kein Sakrileg, ist ist legitim.
#304
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 12:41
Das ist der Punkt auf den ich hinaus wollte.Simifilm: Das Hinterhältige bei Kafka ist, dass dies anscheinend eine wunderbare Welt ist, dass dies aber einzig und allein durch die Verwandlung markiert wird.
Bei den allermeisten Substitutionen müsste meiner Ansicht nach beides modifiziert werden, aber wichtig ist mir die Art & Weise des Erzählens. Knapp könnte man "Die Verwandlung" wohl so zusammenfassen: Gregor stellt fest, dass er sich über Nacht in einen großen Käfer verwandelt hat. Dann wird der veränderte Alltag der Familie Samsa geschildert, die nolens volens mit der neunen Situation umzugehen lernt. Schließlich setzt eine seelische "Verkäferung" Gregors ein, die mit dessen Tod und der Verarbeitung desselben von der Familie endet. Ich halte die Erzählung für eine Groteske, die zwischen Horror/Ekel und Farce schwankt: Würde der Schock stärker in den Vordergrund gestellt, ginge es mehr auf den Horror, würde Käfer-Gregor stärker in einen normalen Alltag eingebunden, ginge es mehr zur Farce. Wenn man nun einfach "Käfer" durch "Mainzelmännchen" ersetzt, bliebe es zwar auf der fiktionalen Ebene dasselbe Wunder, aber die Erzählung erhielt doch einen völlig anderen, absurden Ton. Meiner Ansicht nach erfordert diese Substitution auch eine Änderung der Dramaturgie und wohl auch der Art & Weise des Erzählens. Wie der Ekel mit einem Mainzelmännchen aufgebaut werden könnte, ist mir schleierhaft. Es böte sich allerdings die Farce an. Wenn man nun "Käfer" durch "Krüppel" ersetzt, ginge es wohl in eine ganz andere Richtung - da es ja immerhin möglich ist, aufgrund eines Unfalls oder u.U. aus psychosomatischen Gründen eine Querschnittslähmung zu erhalten, wäre das Wunder "entschärft". Angenommen, es gibt auch in der modifizierten Geschichte keine Erklärung für die Querschnittslähmung, wäre es dann nicht eine fantastische Geschichte im Sinne Todorovs? Eines Morgens wacht ein Mann auf und stellt fest, dass er über Nacht querschittsgelähmt wurde. Man geht zum Arzt, aber der kann keine medizinische Indikation feststellen. Die Familie lernt damit umzugehen, auch wenn das Leben mit Gregor immer schwieriger wird, da er seelisch ebenfalls verkrüppelt. Schließlich stirbt er. Ich meine, dass nur eine Substitution des Käfers durch ein anderes Ungeziefer den generellen Duktus bzw. die Art & Weise des Erzählens der Geschichte erhalten kann, aber selbst wenn sich Gregor in eine Kellerassel oder eine Spinne verwandelte, müsste es deutliche Änderungen beim Futter und der Einrichtung des Zimmers geben. Eben weil der Umgang mit dem Käfer auf der einen Seite so realistisch ist - nur die psychische Reaktion auf die Verwandlung scheint abnorm. Kurzum: Ich weiß nicht in wiefern eine Substitution erhellend wirkt. TheophagosSimifilm: (Ich bin nicht ganz sicher, was Du in diesem Teil mit "narrativer Ebene" meinst? Den dramaturgischen Aufbau oder die Art und Weise, wie erzählt wird?).
- Dr. Karel Lamonte, Atomic Scientist (Top of the Food Chain, Can 1999)
- • (Buch) gerade am lesen:Annick Payne & Jorit Wintjes: Lords of Asia Minor. An Introduction to the Lydians
- • (Buch) als nächstes geplant:Che Guevara: Der Partisanenkrieg
-
• (Buch) Neuerwerbung: Florian Grosser: Theorien der Revolution
-
• (Film) gerade gesehen: Ghost in the Shell (USA 2017, R: Rupert Sanders)
-
• (Film) als nächstes geplant: Onibaba (J 1964, R: Kaneto Shindo)
-
• (Film) Neuerwerbung: Arrival (USA 2016, R: Denis Villeneuve)
#305
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 13:01
Was den Ekel betrifft: Das ist ja nun keine Wirkung, die irgendwie an eine bestimmte Form des Wunderbaren gekoppelt wäre. Man kann Gregor als schleimiges Alien erwachen lassen, dann wäre es wunderbar-eklig, Du kannst ihn aber auch mit einer Magendarmgrippe erwachen lassen, dann ist es realitätskompatibel-eklig. Will sagen: Die Frage, inwiefern diese Verwandlung ekelerregend ist, ist zwar für die Gesamtwirkung wichtig, liegt aber auf einer anderen Ebene als die Frage, inwiefern die Geschichte wunderbar ist.
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#306
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 13:46
Aus »Ideen - Eine Kulturgeschichte von der Entdeckung des Feuers bis zur Moderne« von Peter Watson, S. 466, über Bhamaha, den ersten Literaturtheoretiker des Ostens, Gupta-Dynastie, 5. Jhd. ndZ. Siehe auch die aristotelische Unterteilung in homöopathische (reinkippen lassen) und alotopische (von Außen betrachten) Katharsis. Wobei das Zitat zu Bhamaha sich eher auf die alotopische Katharsis bezieht. Auf die jomöopathische passt ein Zitat aus »Barton Fink«, vom dicken Filmmogul Lipnick:†¦Zweck des Dramas ist entscheidende Ereignisse im irdischen Leben zu imitieren und dem Zuschauern durch verschiedene künstlerische Umsetzungen Beurteilungsmöglichkeiten anzubieten (das heißt, es war nicht das vorrangige Ziel des Dramatikers, das Publikum zur Identifikation mit diesem oder jenem Charakter zu bewegen). Anhand des Dramas sollten die Menschen verstehen lernen, was sensible, komische, heldenhafte, zornige, verständige, mitleidige, entsetzte oder verwunderte Reaktionen jeweils nach sie ziehen konnten. Das Schauspiel sollte vergnüglich und zugleich lehrreich sein.
Und dabei beziehen sich diese beiden Zitate erstmal nur auf die Darstellung von äußerlichen Ereignissen. Das Spiel wird um einiges komplexer, wenn es im Innenwelten geht. Natürlich kann man Ettiketten anbringen. Die Frage ist: Was soll dadurch veranschaulicht (verschleiert) werden? Literaturkritik ist im Grunde ›loben und lästern mit Experten-Set-Extension‹. Der Unterschied ist für mich in etwa so, wie der zwischen Kindern, die ohne Regeln, Würfel und Papierkram Rollenspiele betreiben, und Teens oder (noch) älteren Semestern, die das mit dicken Regelwerken und RPG-Utensilien bewehrt tun (bis hin zum von der Spielleitung abgesegneten Gummischwert). †” Beides, das Kinderspiel und das Expertenspiel, hat seinen Wert und seine Berechtigung! Ich stimme aber Deiner, a3kHHs, Emphase zu, dass man zwecks Gewinnung firscher Blicke ab und zu mit kindlichem (nicht zu verwechseln mit infantilem) Anarchismus an Kunstbewertung herangehen sollte. Solange unsere wissenschaftlichen Instrumente noch nicht dazu taugen, objektive Evaluierungen von Kunstgenuß zu liefern, sollte man sich bemühen, prinzipiell mit Höflichkeit etwaige Differenzen auszutragen. In diesem Sinne stimme ich Simis und Klaus†™ Mahnung zu, hier nicht aus Mutwilligkeit Kinder mit dem Bad auszuschütten. Immerhin: Literaturwissenschaft ist kein Einheitsbrei. Es gibt viele verschiedene Ansätze. Ich selber z.B. habe ich Lauf der Zeit beobachtet, dass es z.B. zwischen Germanistik (hab ich so meine Müh und Not mit) und Anglistik (taugt mir eher, weil imho weniger bescheuklappt) merkliche Unterschiede gibt. Beide beschäftigen sich aber mit Texten. Und auch innerhalb der Germanistik/Anglistik gibt es verschiedene Strömungen und Schulen. Der Teufel liegt im Detail. Back to the Thread-Subject: Theophagos, Du deutest auf die Eigenschaft von Kafkas »Verwandlung«, die ich für die entscheidende Attraktion des Textes halte: das Schweben zwischen Horror und (feiner) Komik (Du nennst es Farce). Imho ist das ein sehr schwerer Balanceakt, und womöglich liegt der Wert von Phantastik darin, dass dieser ›wundersame Erzählmodus‹ es leichter macht, das Neben- und Ineinander solcher schwervermengbaren Stimmungslagen zu ermöglichen. Ich wage die Vermutung, dass es schwerer ist, so ein Kunststück mit rein realitischen Modi zu erreichen. Grüße Alex / moloWe're only interested in one thing, Bart. Can you tell a story? Can you make us laugh? Can you make us cry? Can you make us want to break out in joyous song? Is that more than one thing? Okay!
MOLOSOVSKY IST DERZEIT IN DIESEM FORUM NICHT AKTIV: STAND 13. JANUAR 2013.
Ich weiß es im Moment schlicht nicht besser.
#307
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 14:26
Wenn das Wunderbare von dem Ersetzten abhängt, dann wirkt es meiner Ansicht nach nicht erhellend (oder zumindest nur in engen Grenzen).
Ich glaube aber, dass es letztlich auf diese Frage hinausläuft: Kann die Art & Weise des Erzählens das Wunderbare einer Geschichte wesentlich beeinflussen oder kann sie das Wunderbare nur herausheben bzw. verschleiern?
Nun ob der Wert von Phantastik darin liegt, schwer vermengbare Stimmungslagen zu verbinden, weiß ich nicht, aber dass der realistische Modus das erschwert, sehe ich genauso.Alex:
Imho ist das ein sehr schwerer Balanceakt, und womöglich liegt der Wert von Phantastik darin, dass dieser ›wundersame Erzählmodus‹ es leichter macht, das Neben- und Ineinander solcher schwervermengbaren Stimmungslagen zu ermöglichen. Ich wage die Vermutung, dass es schwerer ist, so ein Kunststück mit rein realitischen Modi zu erreichen.
Theophagos
- Dr. Karel Lamonte, Atomic Scientist (Top of the Food Chain, Can 1999)
- • (Buch) gerade am lesen:Annick Payne & Jorit Wintjes: Lords of Asia Minor. An Introduction to the Lydians
- • (Buch) als nächstes geplant:Che Guevara: Der Partisanenkrieg
-
• (Buch) Neuerwerbung: Florian Grosser: Theorien der Revolution
-
• (Film) gerade gesehen: Ghost in the Shell (USA 2017, R: Rupert Sanders)
-
• (Film) als nächstes geplant: Onibaba (J 1964, R: Kaneto Shindo)
-
• (Film) Neuerwerbung: Arrival (USA 2016, R: Denis Villeneuve)
#308
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 14:30
MOLOSOVSKY IST DERZEIT IN DIESEM FORUM NICHT AKTIV: STAND 13. JANUAR 2013.
Ich weiß es im Moment schlicht nicht besser.
#309
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 14:43
#310
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 15:18
Ich bin mir nicht sicher, ob ein Alien wunderbarer (im Sinne von unmöglicher) ist als ein riesengrosser Käfer, aber es ist eindeutiger einem festen Gattungsinventar zuzuordnen und deshalb leichter als wunderbar erkennbar. Und darum geht es mir: Riesiger Käfer und Alien sind für mich beide gleich wunderbar, wenn man wunderbar als "nicht kompatibel mit der Weltordnung, wie wir sie kennen" versteht. Insofern würde ich eben nicht sagen, dass ein Alien wunderbarer ist, sondern dass es leichter als wunderbar erkennbar ist.Zum Ersetzen. Klar ist, dass wenn der Käfer durch etwas noch Wunderbareres ersetzt wird, wird das Wunderbare der Geschichte verdeutlicht. Aber wird das Wunderbar denn nicht abgeschwächt, wenn die Verwandlung in etwas weniger Wunderbares geschieht? Meine Frage bezgl. des Querschnittgelähmten war da ganz ernst gemeint: Ist es noch eine wunderbare Geschichte, wenn ein Gesunder sich in einen Kranken verwandelt, wenn der Grund nicht zu erkennen ist?
Wenn das Wunderbare von dem Ersetzten abhängt, dann wirkt es meiner Ansicht nach nicht erhellend (oder zumindest nur in engen Grenzen).
Was den Querschnittgelähmten betrifft: Da käme es sehr darauf an, wie das erzählt wird. Das könnte man sicher so erzählen, dass man sich als Leser nichts gross dabei denkt, so im Stil "Aha, der hat offensichtlich eine Krankheit, die zur Lähmung geführt hat". Aber wenn Figuren darüber lamentieren, dass eine solche spontane Lähmung etwas ganz und gar Unmögliches ist dann wird's wieder deutlich wunderbar.
Manche Motive sind eben von Anfang an wunderbar, andere nicht. Ich kann aus der Lähmung auf jeden Fall ein wunderbares Motiv machen, umgekehrt kann ich auch den Käfer oder einen Vampir zu SF machen, wenn ich eine Figur hinstelle, die dafür eine pseudo-wissenschaftliche Erklärung abliefert. Das ist dann alles weniger eine Frage, ob das entsprechende Motiv wunderbar wird, sondern wie seine Wunderbarkeit motiviert ist. Vampir und Alien haben gewissermassen jeweils Default-Erklärungen eingebaut, die man aber mit entsprechendem Aufwand in eine andere Richtung biegen.
Bearbeitet von simifilm, 31 Dezember 2007 - 15:30.
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#311
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 16:20
Modernes Denglisch für "m.E." : "In my humble opinion"Was bedeutet das in Deinem Beitrag zweimal vorkommende Wort imho?
#312
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 16:24
Kann ich den entnehmen, dass du annimmst, dass die Art & Weise des Erzählens das Wunderbare einer Geschichte maßgeblich beeinflussen kann?Simifilm:
Was den Querschnittgelähmten betrifft: Da käme es sehr darauf an, wie das erzählt wird. Das könnte man sicher so erzählen, dass man sich als Leser nichts gross dabei denkt, so im Stil "Aha, der hat offensichtlich eine Krankheit, die zur Lähmung geführt hat". Aber wenn Figuren darüber lamentieren, dass eine solche spontane Lähmung etwas ganz und gar Unmögliches ist dann wird's wieder deutlich wunderbar.
Mir weniger wichtig:
Kant folgend, welche Sätze zwangsläufig, möglicherweise und unmöglich wahr sind, unterteile ich das Wunderbare grob in drei Brüche mit der Realität:Simifilm:
Ich bin mir nicht sicher, ob ein Alien wunderbarer (im Sinne von unmöglicher) ist als ein riesengrosser Käfer, aber es ist eindeutiger einem festen Gattungsinventar zuzuordnen und deshalb leichter als wunderbar erkennbar.
1. Durchaus vorstellbar, aber nicht realisiert: Z. B. "Der gegenwärtige Papst ist ein Franzose, der früher Jacques Chirac hieß." Kein physikalisches Gesetzt, kein logisches Gesetz widerspricht dem, dennoch ist eine Erzählung, in der dieser Satz wahr ist, nicht mimetisch. (In gewissen Maßen) übergroße Tiere oder Technik, die im Einklang mit den Naturgesetzen ist (etwa Unterlichraumschiffe) gehören auch dazu.
2. In "unserer Realität" nicht realisierbar, aber kein logischer Bruch: Z. B. überlichtschnelle Raumschiffe (ohne Austricksen der Relativitätstheorie) oder klassische Fabelwesen wie Feen, Pegasi, Geister und dergleichen.
3. Ein logischer Bruch: Eine Geschichte, in der gegen die Kausalität verstoßen wird (a la Vellum), ein Haus, das Innen größer als Außen ist (a la House of Leaves), ein verheirateter Jungeselle (liebstes Beispiel von Logikern für einen logischen Widerspruch).
Danach wäre ein Alien nicht unbedingt wunderbarer als ein großer Käfer, ein Elf aber in jedem Fall. Ich beharre aber nicht auf das Schema; von mir aus können wir es bei dem "Offensichtlicher-Wunderbar" belassen.
Edit: Noch mal darüber nachgedacht; tatsächlich ist es hier sogar sinnvoller es beim "Offensichtlicher-Wunderbaren" zu belassen; deine Anmerkung ist also eine Richtigstellung.
Keine Ahnung ob das für die Phantastik generell gilt; zumindest aber für "Die Verwandlung".Alex:
Ich wage aber die Behauptung, das dieser Wert ein entscheidener ist.
in my humble opinionKlaus:
Was bedeutet das in Deinem Beitrag zweimal vorkommende Wort imho?
Theophagos
Bearbeitet von Theophagos, 31 Dezember 2007 - 16:32.
- Dr. Karel Lamonte, Atomic Scientist (Top of the Food Chain, Can 1999)
- • (Buch) gerade am lesen:Annick Payne & Jorit Wintjes: Lords of Asia Minor. An Introduction to the Lydians
- • (Buch) als nächstes geplant:Che Guevara: Der Partisanenkrieg
-
• (Buch) Neuerwerbung: Florian Grosser: Theorien der Revolution
-
• (Film) gerade gesehen: Ghost in the Shell (USA 2017, R: Rupert Sanders)
-
• (Film) als nächstes geplant: Onibaba (J 1964, R: Kaneto Shindo)
-
• (Film) Neuerwerbung: Arrival (USA 2016, R: Denis Villeneuve)
#313
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 16:25
MOLOSOVSKY IST DERZEIT IN DIESEM FORUM NICHT AKTIV: STAND 13. JANUAR 2013.
Ich weiß es im Moment schlicht nicht besser.
#314
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 16:37
"Art und Weise" ist nun ja relativ vage, aber grundsätzlich würde ich die Frage mit einem nachdrücklichen Ja beantworten. SF und Phantastik sind für mich im Grunde primär "Arten & Weisen" des Erzählens. Zentral für die verschiedenen Genres/Modi ist ja oft, wie ein wunderbares Element motiviert wird. Wenn diese Motivation für Dich unter "Art & Weise des Erzählens" fällt, dann muss die Antwort ja lauten. Wie schon gesagt: Du kannst mit etwas Aufwand ein Vampir zu SF machen, das ist alles nur eine Frage, wie das Motiv motiviert wird. Manche Motive brauchen von Haus aus keine Motivation, manche - wie der Käfer in die Verwandlung - sorgen ohne explizite Motivation für grosse Verwirrung.Zu dem, was mir am wichtigsten ist, zuerst:
Kann ich den entnehmen, dass du annimmst, dass die Art & Weise des Erzählens das Wunderbare einer Geschichte maßgeblich beeinflussen kann?
Auch wenn es keinen grundsätzlichen Einwand gegen diese Einteilung gibt; in meiner Erfahrung schafft man sich viel Ärger, wenn man mit solchen Kategorien an Texte herantritt, weil man dann schnell in Fachdiskussionen abdriftet, ob eine Zeitreise nun unwahrscheinlicher ist als ein riesengrosser Käfer. Das ist für die Frage, wie der Text funktioniert und wirkt, aber nur selten wirklich relevant. Entscheidend ist da meiner Ansicht weniger die Frage, ob ein Elf genuin wunderbarer ist als grosser Käfer, als die Frage der Konventionalität; also wie geläufig ist ein Motiv, was assoziieren wird damit.Mir weniger wichtig:
Kant folgend, welche Sätze zwangsläufig, möglicherweise und unmöglich wahr sind, unterteile ich das Wunderbare grob in drei Brüche mit der Realität:
1. Durchaus vorstellbar, aber nicht realisiert: Z. B. "Der gegenwärtige Papst ist ein Franzose, der früher Jacques Chirac hieß." Kein physikalisches Gesetzt, kein logisches Gesetz widerspricht dem, dennoch ist eine Erzählung, in der dieser Satz wahr ist, nicht mimetisch. (In gewissen Maßen) übergroße Tiere oder Technik, die im Einklang mit den Naturgesetzen ist (etwa Unterlichraumschiffe) gehören auch dazu.
2. In "unserer Realität" nicht realisierbar, aber kein logischer Bruch: Z. B. überlichtschnelle Raumschiffe (ohne Austricksen der Relativitätstheorie) oder klassische Fabelwesen wie Feen, Pegasi, Geister und dergleichen.
3. Ein logischer Bruch: Eine Geschichte, in der gegen die Kausalität verstoßen wird (a la Vellum), ein Haus, das Innen größer als Außen ist (a la House of Leaves), ein verheirateter Jungeselle (liebstes Beispiel von Logikern für einen logischen Widerspruch).
Danach wäre ein Alien nicht unbedingt wunderbarer als ein großer Käfer, ein Elf aber in jedem Fall. Ich beharre aber nicht auf das Schema; von mir aus können wir es bei dem "Offensichtlicher-Wunderbar" belassen.
Bearbeitet von simifilm, 31 Dezember 2007 - 16:51.
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#315
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 16:39
Me culpa, mea maxima culpa.Klaus, ich heiß Alex oder Molo, nicht Axel.
#316
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 16:45
Wie man am "Simplicissimus" oder am "Faust" sieht, gibt es keine allgemeingültige Zeitgrenze, ab wann irgendetwas veraltet ist. Dies wird unterstrichen an Diskussionen im PR-Forum, dort gibt es einen gewissen Konsens, daß (erst !) 20 oder 30 Jahre alte PRs bereits heute überholt sind. Die von Dir angeführten Werke von Homer respektive das Gilgamesch-Epos erzählen aber eben nichts, was heutzutage noch relevant ist : Freundschaften sind dort oberflächlich, die Charaktere sind archaisch, ihr Verhalten irrational, gewalttätig und sexistisch. Verhält sich heute jemand auch nur in Ansätzen so wie Agamemmnon, wird er schneller eingesperrt, als er "Troja" sagen kann. Und das ist auch gut so. Und genauso sieht es mit Schiller, Goethe et.al. aus : Ihre Weltsicht ist (gottseidank) überholt. Auch der Faust konnte sich nur halten, weil die dortige Diskussion durch Gründgens / Mephisto aktualisiert wurde. Übrigens meinte ich nicht, daß man diese Alt-Werke nicht kennen sollte, insbesondere für den literaturhistorischen Blickwinkel ist eine Beschäftigung mit früheren Werken unumgänglich.Sag doch mal, wann genau die Zeitgrenze zu verorten ist, vor der Werke bedeutungslos für uns heutige sind. Schiller und Goethen sind keineswegs obsolet, weil veraltet. Nimm von mir aus Homer und Gilgamesch: die mögen zwar Mühe breiten, weil sie alt sind, aber dennoch erzählen sie immer noch relevantes über Menschen, Freundschaften, Feindschaften usw.
Nicht alles. Aber das meiste. Insbesondere das Schubladendenken, daß schon vor dreißig Jahren als überholt erkannt wurde. Ganz davon abgesehen, daß solche absolutistischen Einteilungen brandgefährlich sind. Siehe #259Obwohl ich meine persönlichen Schwierigkeiten mit ›akademischer‹ Auseinandersetzung mit Kunst usw hab, halt ichs doch für übertrieben, da alles als Quatsch zu verdammen.
#317
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 16:48
#318
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 16:52
Für jemanden, der sich gegen Schubladendenken und absolute Wahrheitsansprüche und Systeme wehrt, hast Du die absoluten Pauschalaussagen aber verdammt schnell bei der Hand ... Der einzige, der hier absolutistische Einteilungen vornimmt und wertet, was gut und was relevant ist, bist Du ...Wie man am "Simplicissimus" oder am "Faust" sieht, gibt es keine allgemeingültige Zeitgrenze, ab wann irgendetwas veraltet ist. Dies wird unterstrichen an Diskussionen im PR-Forum, dort gibt es einen gewissen Konsens, daß (erst !) 20 oder 30 Jahre alte PRs bereits heute überholt sind. Die von Dir angeführten Werke von Homer respektive das Gilgamesch-Epos erzählen aber eben nichts, was heutzutage noch relevant ist : Freundschaften sind dort oberflächlich, die Charaktere sind archaisch, ihr Verhalten irrational, gewalttätig und sexistisch. Verhält sich heute jemand auch nur in Ansätzen so wie Agamemmnon, wird er schneller eingesperrt, als er "Troja" sagen kann. Und das ist auch gut so. Und genauso sieht es mit Schiller, Goethe et.al. aus : Ihre Weltsicht ist (gottseidank) überholt. Auch der Faust konnte sich nur halten, weil die dortige Diskussion durch Gründgens / Mephisto aktualisiert wurde. Übrigens meinte ich nicht, daß man diese Alt-Werke nicht kennen sollte, insbesondere für den literaturhistorischen Blickwinkel ist eine Beschäftigung mit früheren Werken unumgänglich. Nicht alles. Aber das meiste. Insbesondere das Schubladendenken, daß schon vor dreißig Jahren als überholt erkannt wurde. Ganz davon abgesehen, daß solche absolutistischen Einteilungen brandgefährlich sind. Siehe #259
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#319
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 16:57
Nimm mit Humor, daß mir zu Deiner Sicht der alten Literatur der freche Satz auf der Zunge liegt: "Gelesen, aber nicht verstanden." - Unauslöschlich Gelächter erhoben die seligen Götter, sang Homer. Sie hatten nämlich die nötige ironische Distanz zu allem, die vielen Leuten fehlt. Hinsichtlich des Repertoires an zwischenmenschlichen Problemen und an der Beziehung von Menschen zum Göttlichen (inklusive Transzendenten, Okkulten, Magischen, Phantastischen) findet sich im Fundus der altgriechischen Literatur und des Theaters alles Grundsätzliche, demgegenüber alle späteren Literaten nur Epigonen sind, die immer wieder dieselben Grundeinsichten neu und "zeitgemäß" entdeckten. Das gilt sogar für das Genre des ins Mythische greifenden Abenteueromans. Was Jason oder Odysseus erlebten, bildet keinen prinzipiellen narrativen Unterschied zum Weltraumhelden unserer Zeit.Wie man am "Simplicissimus" oder am "Faust" sieht, gibt es keine allgemeingültige Zeitgrenze, ab wann irgendetwas veraltet ist. Dies wird unterstrichen an Diskussionen im PR-Forum, dort gibt es einen gewissen Konsens, daß (erst !) 20 oder 30 Jahre alte PRs bereits heute überholt sind. Die von Dir angeführten Werke von Homer respektive das Gilgamesch-Epos erzählen aber eben nichts, was heutzutage noch relevant ist : Freundschaften sind dort oberflächlich, die Charaktere sind archaisch, ihr Verhalten irrational, gewalttätig und sexistisch. Verhält sich heute jemand auch nur in Ansätzen so wie Agamemmnon, wird er schneller eingesperrt, als er "Troja" sagen kann. Und das ist auch gut so. Und genauso sieht es mit Schiller, Goethe et.al. aus : Ihre Weltsicht ist (gottseidank) überholt. Auch der Faust konnte sich nur halten, weil die dortige Diskussion durch Gründgens / Mephisto aktualisiert wurde. Übrigens meinte ich nicht, daß man diese Alt-Werke nicht kennen sollte, insbesondere für den literaturhistorischen Blickwinkel ist eine Beschäftigung mit früheren Werken unumgänglich. Nicht alles. Aber das meiste. Insbesondere das Schubladendenken, daß schon vor dreißig Jahren als überholt erkannt wurde. Ganz davon abgesehen, daß solche absolutistischen Einteilungen brandgefährlich sind. Siehe #259
#320
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 17:20
Erster Satz deckt sich mit meiner Ansicht, dass es sowas wie ›ewige Klassiker‹ gibt, die aus dem Hin- und Her des Laufs der Moden herausragen. †” Ansonsten: Erkenntnisse aus einem PR-Forum nehme ich als PR-Verachter natürlich nur als Belustigung zu Kenntnis, aber keineswegs für voll.Wie man am "Simplicissimus" oder am "Faust" sieht, gibt es keine allgemeingültige Zeitgrenze, ab wann irgendetwas veraltet ist. Dies wird unterstrichen an Diskussionen im PR-Forum, dort gibt es einen gewissen Konsens, daß (erst !) 20 oder 30 Jahre alte PRs bereits heute überholt sind.
Erfrischend optimistisch. Als jemand, der Homer ›nur‹ in deutschen und englischen Fassung gelesen hat, bin ich so frei, mich dem Klaus†™schen Gelächter anzuschließen. Ansonsten stimme ich Dir natürlich zu, wenn es um die Beknacktheit von regidem, starrem, hierarchischen Schubladendenken geht. Wie Simi lege ich also nahe: weniger Schwarz/Weiß-Überspitzerei würde Deine Position immuner machen. †” Beginn doch vielleicht neu und versuch mal, Deine Auffassung des »Phantastik-Begriffs« zu schildern. Simis letzter Beitrag bringt wiederum m.E. (HA, ich bin lernfähig) beherzigenswertes auf den Punkt. †¢ SF und vor allem Phantastik lassen sich besser als Modi fassen. †¢ Das Abwägen, ob die Eigenheiten eins bestimmten Werkes eher konventionell oder unkonventionell sind, bzw. ob ein Werk eher bereits bestehende Formeln bestätigt oder sie durchbricht, ist m.E. gewinnbringender als die Frage, wie ›konform mit objektiv bestätigter Faktenlage die Wirklichkeit betreffend‹ ein Werk ist. Fiktionen genießen nun mal ein eignes Wahrheits-Privileg (sprich: innerhalb einer Fiktion bleiben selbst die mit der tatsächlichen Wirklichkeit nicht kompatiblen Irrwitzigkeiten, Lügen usw. eben wahr. Das Dritte Reich hat den 2. Weltkrieg in der Wirklichkeit verlohren; diese Aussage ist aber z.B. innerhalb. der Fiktions-Welten von »Orakel vom Berge« oder »Vaterland« unwahr.) Letzteres (= der Faktenlage zu folgen und nicht z.B. abergläubischen Phantasmen) ist wichtig für politische und wissenschaftliche Diskurse, aber im Reich der Poesie, Dichtung und Fiktions-Unterhaltung weniger von zentraler Bedeutung. †” (Wobei ich mir selbst hier widersprechen will: Erzählungen sind nun mal DER Verführungsweg, um Mythen, Realitätstunnel zu formen und zu bündeln. Dazu hab ich zuletzt hier auf einen entsprechend lesenswerten »Le Monde Diplomatique« reagiert. Aber dort geht es ja um die gefährliche Vermischung von Politik und Großraumphantastik. Propaganda ist nichts anderes als strategische Mythenverbreitung. Heut nennt sich das Infowar.) Grüße Alex / moloVerhält sich heute jemand auch nur in Ansätzen so wie Agamemmnon, wird er schneller eingesperrt, als er "Troja" sagen kann. Und das ist auch gut so.
Bearbeitet von molosovsky, 31 Dezember 2007 - 17:27.
MOLOSOVSKY IST DERZEIT IN DIESEM FORUM NICHT AKTIV: STAND 13. JANUAR 2013.
Ich weiß es im Moment schlicht nicht besser.
#321
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 17:32
Vielleicht noch ergänzend zu den Konventionen: Die entstehen ja nicht aus dem Nichts, sondern können durchaus durch die aussertextliche Welt motiviert sein (und hier sehe ich auch den Hauptunterschied zwischen dem Ansatz der Todorov-Durst-Achse und meinem). Das zeigt sich ja auch in der SF sehr schön. Poe könnte in The Strange Case of M. Valdemar noch Magnetismus als quasi-wissenschaftliche Erklärung heranziehen; das würde heute schwierig. Oder: Eine Zeit lang konnten radioaktive Strahlen in der SF alles Mögliche, Leute schrumpfen, mutieren etc. Das ist einerseits eine durch tatsächliche Begebenheiten motivierte Konvention (Hiroshima hat den Leuten gezeigt, die Macht der Atombombe demonstriert), heute ist es aber überholt, da es mittlerweile zum Allgemeinwissen gehört, dass radioaktive Strahlung längst nicht all die wilden Dinge tun kann.
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#322
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 17:40
Vielleicht sinds die Feiertage, die mich milder machen, vielleicht ists der Einfluß meiner derzeitigen Lektüren, vielleicht der Umstand, dass ich mich geistig in Stellung bringe, einen Beitrag für ein Literatur & Germanistik-Magazin zu schreiben (ooooooh ja, werde ich Autodidakt und Dilettant dem Anspruch gerecht werden können ... fingernägelknabber).
Du (und andere, die mich schon länger in Foren ›ertragen‹) hast sicherlich gemerkt, dass mich die unterschiedlichsten Vermischung von Fakten und Fiktionen besonders umtreiben. Freut mich, dass ich derzeit Deinem Lob entsprechend ein geschicktes Händchen dafür habe, kenntlich zu machen, wann ich mich wie auf was beziehe.
Grüße
Alex / molo
EDIT-Nachtrag zum Thema:
Man nehme »Dracula« von Storker. Van Helsing (der echte, nicht die Aussi-Locke aus dem Lollipop-Film mit Jackman) wird darin als ›akademische Koriphäe‹ vorgestellt, der sich äußerst ›wissenschaftlich‹ über Vampirismus ausläßt. †” Natürlich ist das alles wilder Quatsch, ein wüstes Potpourrie aus Volksaberglauben und pionier-medizinischen Vokabeln des 19. Jhds. Jedoch gleicht die Art und Weise, wie hier mittels ›quasi-wissenschaftlicher‹ (z.B. aber eben mehr theologisch-magischer) Terminologie das Monster erklärt wird, den moderneren Realitätskompatibilitäs-Markierungen der SF sehr. †” Das allein bringt mich sowohl zum Schaudern als auch zum Schmunzeln.
Noch ein Nachtrag:
Poe und »Der Fall Valdemar«. Die Pionierzeit des (Elektro-)Magnetismus, bzw. des Mesmerisus taugt auch heute noch für ungemein kräftige Phantastik. Ich erinnere da an den Verschwörungstheorie-Treibsand der Kulturellen Enzyklopadie zu Nicola Tesla, hervorragend genutzt z.B. von Christopher Priest in »The Prestige« oder jüngst von Thomas Pynchon in »Against the Day« oder auch mittels der Geheimforschung der DHARMA-Initioative in der Serie »Lost«.
Bearbeitet von molosovsky, 31 Dezember 2007 - 17:50.
MOLOSOVSKY IST DERZEIT IN DIESEM FORUM NICHT AKTIV: STAND 13. JANUAR 2013.
Ich weiß es im Moment schlicht nicht besser.
#323
Geschrieben 31 Dezember 2007 - 21:52
Alex, ich verstehe dein Argument nicht so recht. Ob ein Werk Genrekonventionen bestätigt oder durchbricht halt ich stets für wichtig, aber diese Frage ersetzt meines Erachtens nicht die Frage, in welcher Art ein Wunder mit der westlich-wissenschaftlichen Weltanschauung (um die geht es mir; nicht um objektive Fakten) bricht. Als Beispiel: Ich kenne viele Anhänger mimetischer Werke, die einen Bruch der ersten Kategorie wohl noch hinnehmen könnten, einen der zweiten oder dritten aber nie akzeptieren würden; gleichwohl lieben diese Leser unkonventionelle Erzählungen. Umgekehrt kenne ich einige Fantasy- & SF-Fans, die Werke ohne Bruch für phantasielos (=langweilig) halten, aber keine Brüche der Genrekonventionen akzeptieren. Ich glaube die beiden Fragen haben jeweils ihren Wert in unterschiedlichen Situationen. Weiter schein mir die Unterscheidung, ob "Vaterland" ein historischer Roman oder eine Uchronie ist, eine wichtige zu sein, gleichwie ob es in der "Hitler-Wins-War"-Tradition steht oder nicht. TheophagosAlex: †¢ Das Abwägen, ob die Eigenheiten eins bestimmten Werkes eher konventionell oder unkonventionell sind, bzw. ob ein Werk eher bereits bestehende Formeln bestätigt oder sie durchbricht, ist m.E. gewinnbringender als die Frage, wie ›konform mit objektiv bestätigter Faktenlage die Wirklichkeit betreffend‹ ein Werk ist. Fiktionen genießen nun mal ein eignes Wahrheits-Privileg (sprich: innerhalb einer Fiktion bleiben selbst die mit der tatsächlichen Wirklichkeit nicht kompatiblen Irrwitzigkeiten, Lügen usw. eben wahr. Das Dritte Reich hat den 2. Weltkrieg in der Wirklichkeit verlohren; diese Aussage ist aber z.B. innerhalb. der Fiktions-Welten von »Orakel vom Berge« oder »Vaterland« unwahr.)
- Dr. Karel Lamonte, Atomic Scientist (Top of the Food Chain, Can 1999)
- • (Buch) gerade am lesen:Annick Payne & Jorit Wintjes: Lords of Asia Minor. An Introduction to the Lydians
- • (Buch) als nächstes geplant:Che Guevara: Der Partisanenkrieg
-
• (Buch) Neuerwerbung: Florian Grosser: Theorien der Revolution
-
• (Film) gerade gesehen: Ghost in the Shell (USA 2017, R: Rupert Sanders)
-
• (Film) als nächstes geplant: Onibaba (J 1964, R: Kaneto Shindo)
-
• (Film) Neuerwerbung: Arrival (USA 2016, R: Denis Villeneuve)
#324
Geschrieben 01 Januar 2008 - 11:09
#325
Geschrieben 01 Januar 2008 - 13:36
Was Du über verschiedene Leserhaltungen erzählst, ist mir auch schon untrergekommen. Dennoch finde ich diese einseitige Wirklichkeits/Unwirklichkeitsabklopfung etwas mager.
Immerhin liegt bei einem narativem/fiktionalem Werk stets ein in- und miteinander von Form und Inhalt vor, und diese beiden Dinge lassen sich nicht endgültig voneinder getrennt betrachten. ›Wie‹ und ›was‹ erzählt wird bildet nun mal eine Einheit. †” Ich selber finde es ein klein wenig müßig, sich da nur auf eines der beiden zu konzentrieren. Zudem gibts da noch weitere Eigenschaften, wie z.B. welche Milieus, welche Settings herangezogen werden, wie ›glatt‹ oder ›hart‹ ist die Sicht auf Charaktere oder wie ist das (ich nenns mal) ›Weltempfinden‹ eines Werkes geartet (kann man grob in FSK-Freigaben messen).
Deine Beispiele finde ich aber dennoch interessant.
Der erste Fall ist wohl der typische ›Phantastik-Phobe‹. Satierische Spielchen mit der Fakenwirklichkeit sind gestattet, aber nach dem Motto: »Bitte bloß nicht Wundersames«. Arme Geister das, seufz.
Zur zweiteren Beispielgruppe hätte ich gerne ein Beispiel, denn obwohl mir Deine Schilderung was sagt, fällt mir da im Augenblick nichts wirklich sinnfäliges ein (bin vielleicht noch zu sehr am Verdauen der Sylvesterschlemmerei und mein Hirn ermangelt die nötige Blutversorgung
Und »Vaterland« ist freilich eine Uchronie.
Allgemein: Phantastik (im Sinne von Horror, SF & Fantasy-Trias & Angrenzendes) zeichnet sich m.E. vor allem durch zwei Eigenschaften aus:
†¢ einmal, dass durch die Möglichkeiten der Phantastik noch stärker übertrieben/untertrieben werden kann, als im realistischen Modus; dies könnte man den ›poetischen Afterburner‹ der Phantastik nennen.
†¢ dann, dass Phantastik ein Modus der Schwebe und des Flackerns ist, bei dem die phantatsischen Über/Untertreibung als Metapher funktionieren (als überspitzte Kommentare zur Echtwelt genommen werden können), aber ›zugleich‹ für sich selber ästhetischen Reize als ›freies Spiel des Geistes‹ bieten. Das ›zugleich‹ ist natürlich eine Idealisierung, denn viele phantastische Werke neigen mal mehr zum einen oder anderen (wenn Phantastik statt schwebenden Metaphern eindeutige Allegorien bietet; bzw. die Metaphernkraft ›schwach‹ ist, und sich Phantastik mehr auf das Spiel mit Faszination und Spektakel konzentiert).
Wiederum ist dieses Einteilen aber etwas trocken, da die Formebene, das ›Wie‹ des Erzählens, der Umgang mit Sprache und Struktur (im weitesten Sinne: der Umgang mit Raum und Zeit und Perspektiven) hier unter den Tisch fällt.
Soweit dazu im Augenblick.
Grüße
Alex / molo, der ebenfalls allen hier ein gutes neues Jahr wünscht.
Bearbeitet von molosovsky, 01 Januar 2008 - 13:43.
MOLOSOVSKY IST DERZEIT IN DIESEM FORUM NICHT AKTIV: STAND 13. JANUAR 2013.
Ich weiß es im Moment schlicht nicht besser.
#326
Geschrieben 01 Januar 2008 - 14:49
Geschenkt. Es ging mir nur darum, darauf hinzuweisen, dass die Frage nach der Art des Bruches (mit der westlich-wissenschaftlichen Weltanschauung) ihre Berechtigung hat bzw. haben kann - an einen mimetischen Roman diese Frage heranzutragen wäre zwecklos; dennoch hat er ja Qualitäten. Warum sollten nun phantastische Roman keine Qualitäten habe? Ich halte die Art des Bruchs aber auch für eine Qualität des phantastischen Romans, den man nicht per se unter dem Tisch fallen lassen sollte.Immerhin liegt bei einem narativem/fiktionalem Werk stets ein in- und miteinander von Form und Inhalt vor, und diese beiden Dinge lassen sich nicht endgültig voneinder getrennt betrachten. ›Wie‹ und ›was‹ erzählt wird bildet nun mal eine Einheit. †” Ich selber finde es ein klein wenig müßig, sich da nur auf eines der beiden zu konzentrieren.
Ein schwuler Zwergenschmied, der sich vom Halblingstricher ficken (dies ist keine Metapher) lässt, wäre zweifellos ein solcher Bruch. Was genau als Bruch wahrgenommen wird, ist natürlich vom einzelnen Rezipienten abhängig, aber ich habe in letzter Zeit einen deutlichen Ruf nach diesbezüglicher Konservativität vernommen. In seinem Artikel Fantasy, RPGs, Innovation, and Bile kommt Joe Abercrombie zu folgendem Schluss: "The fact is, for the vast majority of readers (and I think I probably count myself among them), too much innovation is boring. Too much innovation is pretentious. Too much innovation is ... wank." Er will das gar nicht so sehr auf Literatur bezogen wissen, aber viele Leser stimmen ihm von ganzen Herzen zu. Von einem Leser weiß ich z. B., dass er Bier trinkende Elfen für falsch hält. ("Die trinken Elfenwein, vielleicht noch gute menschliche Weine, aber kein Zwergengesöff!")Zur zweiteren Beispielgruppe hätte ich gerne ein Beispiel, denn obwohl mir Deine Schilderung was sagt, fällt mir da im Augenblick nichts wirklich sinnfäliges ein (bin vielleicht noch zu sehr am Verdauen der Sylvesterschlemmerei und mein Hirn ermangelt die nötige Blutversorgung smile.gif ) †” Wäre ein hedonistischer, Falstaff†™ischer Vulkanier so ein Bruch mit einer Genre-Konvention? Oder ein ›Fett-Elf‹, also ein Elf mit der Figur eines Sumoringers (nebenbei: gibts Orks mit Bärten)?
Und meiner Ansicht ist eine Uchronie enger mit einer Utopie als mit der Sword & Sorcery verwand; ich hoffe, die Frage nach der Art des Bruchs trägt in diesem Fall zur Erhellung bei. Theophagos Edit: Ach, ja, auch mir allen ein frohes neues.Und »Vaterland« ist freilich eine Uchronie.
Bearbeitet von Theophagos, 01 Januar 2008 - 14:49.
- Dr. Karel Lamonte, Atomic Scientist (Top of the Food Chain, Can 1999)
- • (Buch) gerade am lesen:Annick Payne & Jorit Wintjes: Lords of Asia Minor. An Introduction to the Lydians
- • (Buch) als nächstes geplant:Che Guevara: Der Partisanenkrieg
-
• (Buch) Neuerwerbung: Florian Grosser: Theorien der Revolution
-
• (Film) gerade gesehen: Ghost in the Shell (USA 2017, R: Rupert Sanders)
-
• (Film) als nächstes geplant: Onibaba (J 1964, R: Kaneto Shindo)
-
• (Film) Neuerwerbung: Arrival (USA 2016, R: Denis Villeneuve)
#327
Geschrieben 01 Januar 2008 - 15:08
Dass gerade die Leser von Genre-Literatur (im Sinne von koventionalisierter Massenliteratur) konservativ sind, ist nichts Neues. Wer seit 40 Jahren Perry Rhodan liest, tut dies ja, weil er gewisse Dinge wiederfinden will und nicht weil er etwas lesen will, bei dem er keine Ahnung hat, was ihn erwartet. Natürlich können auch Serien mehr oder weniger konservativ sein und durchaus versuchen, mit ihren Konventionen zu spielen. Aber der empörte Aufruf gewisser Fans "Halt, das darf man nicht. Das ist nicht im Sinne der Urserie" gibt es eigentlich immer. Diesbezüglich gibt es auch interessante Untersuchen zu den Fans von TV-Serien. Für viele Fans von Genreliteratur geht es zu einem nicht geringen Teil um die Lust an der Wiederholung. Edit: "Konservativ" bezieht sich hier natürlich nur auf den Geschmack und ist nicht politisch gemeint.Was genau als Bruch wahrgenommen wird, ist natürlich vom einzelnen Rezipienten abhängig, aber ich habe in letzter Zeit einen deutlichen Ruf nach diesbezüglicher Konservativität vernommen. In seinem Artikel Fantasy, RPGs, Innovation, and Bile kommt Joe Abercrombie zu folgendem Schluss: "The fact is, for the vast majority of readers (and I think I probably count myself among them), too much innovation is boring. Too much innovation is pretentious. Too much innovation is ... wank." Er will das gar nicht so sehr auf Literatur bezogen wissen, aber viele Leser stimmen ihm von ganzen Herzen zu. Von einem Leser weiß ich z. B., dass er Bier trinkende Elfen für falsch hält. ("Die trinken Elfenwein, vielleicht noch gute menschliche Weine, aber kein Zwergengesöff!")
Bearbeitet von simifilm, 01 Januar 2008 - 15:09.
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#328
Geschrieben 01 Januar 2008 - 15:19
MOLOSOVSKY IST DERZEIT IN DIESEM FORUM NICHT AKTIV: STAND 13. JANUAR 2013.
Ich weiß es im Moment schlicht nicht besser.
#329
Geschrieben 01 Januar 2008 - 15:24
Nun ja, ich habe ja auch nicht von Dir gesprochen, sondern sehr allgemein. Oder bist Du ein heimlicher Perry-Rhodan-Leser?Auf diesem Ohr der ›Lust der Wiederholung‹ bin ich ziemlich unmusikalisch. Dadurch verkommen Werke eben zu ›Nicht-Orten‹, so wie McDonalds, Starbucks, Ikea, Cluburlaubs-Oasen oder Flughäfen überall auf der Welt gleich sind. Das ist auf gewisse Weise das Gegenteil von dem, was für mich den Reiz von Phantastik ausmacht.
Für "Lost" konnte ich mich ja nie begeistern, aber als Liebhaber von "Simpsons" und "Desperate Housewives" habe ich keine Probleme zuzugeben, dass der Reiz dieser Serien auch darin liegt, dass man die Figuren eben kennengelernt und liebgewonnen hat und dass man gewisser Momente wieder- und neuerleben will. Natürlich liegt die Qualität dieser beiden Serien auch darin, dass sie die Muster variieren, aber sind eben Variationen des Bekannten. Wenn Homer nun längefristig Diät machen und zu einem hilfsbereiten, intelligenten Zeitgenossen würde, hätte ich daran gar keine Freude.Bei dem wenigen, was ich an Serien verköstige, reizt mich auch mehr der ausführliche Dramaturgie-Bogen der möglich ist. Und ich bevorzuge eindeutig abgeschlossene ›Serien‹, am besten solche, die von Beginn an auf eine bestimmte Länge hin geplant sind. †” Wie nervig ist bei »Akte X« z.B. dieses Ausfransen ins Nichtige bei den letzten Staffeln, das ewige Weiter-Weiter von vielen Comic-Reihen oder solchen Endlossagas wie eben »Perry Rhodan«, und wie großartig ist dagegen die Wirkung von modernen ›Tele-Novelas‹ wie »The Sopranons«, »Six Feet Under« oder »Lost«.
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#330
Geschrieben 01 Januar 2008 - 15:39
MOLOSOVSKY IST DERZEIT IN DIESEM FORUM NICHT AKTIV: STAND 13. JANUAR 2013.
Ich weiß es im Moment schlicht nicht besser.
Besucher die dieses Thema lesen: 1
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0