Politikwissenschaft würde ich den Geisteswissenschaften zuordnen. Eine wenig sorgfältige Behandlung von politischen und sozialen Themen fällt daher in den geisteswissenschaftlichen Bereich. Natürlich ist diese Klassifikation sehr oberflächlich.Das habe ich auch nicht verstanden.
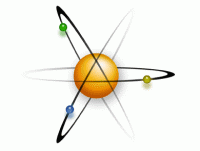
Umfrage Nr. 01: Euer bevorzugtes SF-Genre?
#31
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:02
#32
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:03
Hallo, P.P. Doc Müller, ich wollte Dich natürlich nicht beleidigen, aber die pulp fiction, bei der ich bis zum Ende durchhielt, fand ich eigentlich oft ziemlich komisch. (Ich dachte speziell an E.R. Burroughs - falls das kein Pulp ist, wäre das natürlich mein Fehler.) Grüße, Rainer"Pulp" hat nichts mit "komisch" zu tun. Pulp-SF war die in billig gemachten Magazinen erscheinende SF des Golden Age, klassisches Beispiel ist E. E. Doc Smith (der gleichzeitig die Space Opera erfunden hat...). Das waren durchaus ernst gemeinte Veröffentlichungen.
#33
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:06
Was meinst Du? Die Carter-Romane? Die sind möglicherweise aus heutiger Sicht "komisch", sind aber durchaus "ernst" gemeinte Abenteuerliteratur. Und viele der klassischen SF-Heuler sind hin und wieder heute sicher unfreiwillig komisch, aber gedacht war es so nicht. Pulp-SF ist klassische, fix heruntergeschriebene Abenteuer-SF, mit Bug-eyed-monsters, kreischenden Frauen, bösen Overlords und heldigen Helden.Hallo, P.P. Doc Müller, ich wollte Dich natürlich nicht beleidigen, aber die pulp fiction, bei der ich bis zum Ende durchhielt, fand ich eigentlich oft ziemlich komisch. (Ich dachte speziell an E.R. Burroughs - falls das kein Pulp ist, wäre das natürlich mein Fehler.) Grüße, Rainer
"Alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, für Geld getan zu werden."
(13. Erwerbsregel)
"Anyone who doesn't fight for his own self-interest has volunteered to fight for someone else's."
(The Cynic's book of wisdom)
Mein Blog
#34
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:10
Was hat Politikwissenschaft mit der Frage zu tun, ob ich jemanden wegen eines illegalen Raumfluges oder herumgeschlepptem Uran verfolge? Nein, ich will das Thema nicht totreden und glaube zumindest zu ahnen, was Du meinst. Aber die pauschale Zuweisung von allem, was nix mit Elektronen, Legierungen und dem Flux-Kompensator zu tun hat, in die Geisteswissenschaften, obgleich das möglicherweise bloß konstruierte plot devices sind, finde ich grenzwertig. Oder, Gegenbeispiel: Man kann sich durchaus darüber unterhalten, ob die von L. Neil Smith in seinen Romanen beschriebene anarcho-kapitalistische Gesellschaft funktional ist oder nicht, und man kann zu dieser Diskussion gewisse empirische Erkenntnisse aus Soziologie und Ökonomie heranziehen, genauso wie aus der Politikwissenschaft. Auf dieser Basis kann man dann seinen Romanen möglicherweise vorwerfen, als Utopie schlecht zu funktionieren. Das ist eine Ebene, die ich für diskussionswürdig halte. Die genannten Beispiele haben mit derlei aber herzlich wenig zu tun.Politikwissenschaft würde ich den Geisteswissenschaften zuordnen. Eine wenig sorgfältige Behandlung von politischen und sozialen Themen fällt daher in den geisteswissenschaftlichen Bereich. Natürlich ist diese Klassifikation sehr oberflächlich.
Bearbeitet von Diboo, 21 Juli 2009 - 13:11.
"Alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, für Geld getan zu werden."
(13. Erwerbsregel)
"Anyone who doesn't fight for his own self-interest has volunteered to fight for someone else's."
(The Cynic's book of wisdom)
Mein Blog
#35
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:13
Nur weil ein Roman politische, psychologische, soziale etc. Themen anschneidet, wird er deswegen doch noch nicht geisteswissenschaftlich. Die Psychologie der Figuren ist ja doch bei den allermeisten Romanen bis zu einem gewissen Grad wichtig, deswegen werden sie aber noch nicht psychologisch im Sinne der Wissenschaft Psychologie.Politikwissenschaft würde ich den Geisteswissenschaften zuordnen. Eine wenig sorgfältige Behandlung von politischen und sozialen Themen fällt daher in den geisteswissenschaftlichen Bereich. Natürlich ist diese Klassifikation sehr oberflächlich.
«Geisteswissenschaftlich richtig» ist ohnehin ein sehr problematischer Ausdruck, da es in den allermeisten (allen?) Geisteswissenschaften mehrere konkurrierende Theorien gibt und das Urteil «richtig» oder «falsch» meist gar nicht möglich ist.
Es gibt durchaus Romane, die auf einer bestimmten geisteswissenschaftlichen Theorie aufbauen (spontan fällt mir Delany ein, der beispielsweise in Babel-17 stark von der Linguistik ausgeht), aber dadurch werden sie auch nicht «geisteswissenschaftlich richtig». Gerade Babel-17 wäre ein Beispiel dafür: Das Buch ist ohne Zweifel stark von Delanys Auseinandersetzung mit der Linguistik/Strukturalismus beeinflusst, was da an «Sprachwissenschaftlichem» erzählt wird, ist aber weitgehend Phantasterei. Das ist keineswegs als Vorwurf gemeint, sondern soll nur zeigen, dass selbst in diesem Fall nicht von geisteswissenschaftlicher Richtigkeit gesprochen werden kann.
Oder nehmen wir als extremes Beispiel Walden Two von B.F. Skinner. Skinnder war eine Kapazität auf dem Gebiet der (behaviouristischen) Psychologie. Sein Roman ist eine Art behaviouristische Utopie, die dank konsequenter Anwendung seiner Theorien wunderbar funktioniert. Man erkennt hier klar eine bestimmte theoretische Grundierung, «geisteswissenschaftlich richtig» oder «korrekt» wird der Roman dadurch aber nicht; schon alleine weil Skinners Theorie auch immer sehr umstritten war und ist.
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#36
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:16
Vielleicht: Planetary Romance (Abenteuer auf exotischen Planeten), obwol mir der Begriff bisher unbekannt war. Aber meine größte Leidenschaft gilt Abenteuerromanen, egal in welchem Genre sie geschrieben sind (Fantasy, History, SF). Ich denke da z. B. an Jack Vances "Planet der Abenteuer".@ pirandot, Pogopuschel: Ich lese auch quer durch die (Sub-)Genres, aber habt Ihr nicht auch Vorlieben innerhalb der SF? Ein paar Subgenres, die Ihr doch lieber moegt als andere?
Mein Blog: http://translateordie.wordpress.com/ Meine Buchbesprechungen: http://lesenswelt.de/
#37
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:22
#38
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:27
Auch das scheint mir nicht ausschlaggebend; denn damit machst daraus eine Art Qualitätskriterium. Wenn ich die Einteilung richtig verstehe, ist aber eine inhaltliche Betonung viel entscheidender. Skinner geht es um Psychologie, Delany um Linguistik. Über die Frage, wie sorgfältig die damit umgehen, ist damit nichts gesagt. Entsprechende Theorien und Konzepte sind aber in beiden Fällen für den Inhalt der Romane zentral.Zum Thema "Richtigkeit" wird es übrigens in den nächsten Wochen auch eine Umfrage geben. "Sorgfältig" wäre sicher eine treffendere Bezeichnung gewesen.
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#39
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:28
Das ist einer der Vorzeigeromane des "Planetary Romance"-Genres. http://en.wikipedia....anetary_romanceIch denke da z. B. an Jack Vances "Planet der Abenteuer".
#40
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:38
Ob die Inhalte zentral sind, soll auch nicht das entscheidende Kriterium sein, sondern tatsächlich die Sorgfältigkeit. Ein Roman ist auch noch nicht Hard SF, nur weil er mit "Technogebabbel" vollgestopft ist. Aber lass uns die Diskussion auf die entsprechende Umfrage vertagen.Entsprechende Theorien und Konzepte sind aber in beiden Fällen für den Inhalt der Romane zentral.
#41
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:42
#42
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:47
Ok, Du verstehst anscheind nicht, was ich Dir zu erklären versuche, namlich dass «geisteswissenschaftlich korrekt» oder «sorgfältig» ein unsinniges Kriterium ist; dann lassen wir's eben.Ob die Inhalte zentral sind, soll auch nicht das entscheidende Kriterium sein, sondern tatsächlich die Sorgfältigkeit. Ein Roman ist auch noch nicht Hard SF, nur weil er mit "Technogebabbel" vollgestopft ist. Aber lass uns die Diskussion auf die entsprechende Umfrage vertagen.
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#43
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:53
#44
Geschrieben 21 Juli 2009 - 13:57
Rein formal betrachtet ist Mathematik die 1a-Geisteswissenschaft - wird heute nur gerne übersehen, weil die Naturwissenschaften sie so sehr als Hilfswissenschaft vereinnahmt haben, dass das abfärbtDass man Mathematik als Geisteswissenschaft bezeichnet, wär' mir nun doch eher neu ...
Ich verstehe deinen Einwand - aber ich hatte trotzdem sofort diese Assoziation, als ich den Abstimmungspunkt las. Und ich war durchaus geneigt, alle Mängel, die gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen, genau wie psychologischen, juristischen etc. unter dem Label "geisteswissenschaftlich" zu subsummieren. Ich denke mal, als Abgrenzung zu "Naturwissenschaftlich" trifft es durchaus den Punkt. Und, @simi - es gibt durchaus in Geistes- bzw. Gesellschaftswissenschaften Aussagen, die einfach nur falsch oder hanebüchen sind, und nicht irgendwelchen "konkurrierenden Theorien" zugerechnet werden können. Man will ja nicht in blinden Relativismus verfallen - unbegründeten, an den Haaren herbeigezogenen Schwachsinn darf man auch in den Geisteswissenschaften so nennenNein, ich will das Thema nicht totreden und glaube zumindest zu ahnen, was Du meinst. Aber die pauschale Zuweisung von allem, was nix mit Elektronen, Legierungen und dem Flux-Kompensator zu tun hat, in die Geisteswissenschaften, obgleich das möglicherweise bloß konstruierte plot devices sind, finde ich grenzwertig.
#45
Geschrieben 21 Juli 2009 - 14:04
Ich verstehe dieses Argument natürlich schon; es ist aber dennoch eine sehr andere Art von Geisteswissenschaft als Germanistik, Geschichte oder Psychologie.Rein formal betrachtet ist Mathematik die 1a-Geisteswissenschaft - wird heute nur gerne übersehen, weil die Naturwissenschaften sie so sehr als Hilfswissenschaft vereinnahmt haben, dass das abfärbt
Aber Mathematik befasst sich nur mit geschlossenen Modellen ohne empirische Grundlage.
Keine Frage, aber das hat wiederum wenig mit den Romanen zu tun - siehe mein Delany-Beispiel. Babel 17 ist definitiv stark von der Linguistik beeinflusst und ist "streng geisteswissenschaftlich, sprich: linguistisch, gesehen" dennoch Unsinn. Dennoch würde der Roman wohl in die Kategorie fallen, die hier gemeint sein soll. Genau deshalb finde ich ja, dass «geisteswissenschaftlich richtig» eine untaugliche Kategorie ist. «Von geisteswissenschaftlichen Theorien inspiriert» trifft es eher; das geht dann in die Richtung von TrashStars «Werke mit philosophischem Hintergrund».Und, @simi - es gibt durchaus in Geistes- bzw. Gesellschaftswissenschaften Aussagen, die einfach nur falsch oder hanebüchen sind, und nicht irgendwelchen "konkurrierenden Theorien" zugerechnet werden können. Man will ja nicht in blinden Relativismus verfallen - unbegründeten, an den Haaren herbeigezogenen Schwachsinn darf man auch in den Geisteswissenschaften so nennen
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#46
Geschrieben 21 Juli 2009 - 14:08
Das halte ich für einen guten Formulierungsvorschlag. Der ist übrigens auch für die Naturwissenschaften gültig. Nicht jeder SF-Autor verfügt über entsprechende Kenntnisse. Fragt mich mal.Kategorie ist. «Von geisteswissenschaftlichen Theorien inspiriert» trifft es eher;
"Alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, für Geld getan zu werden."
(13. Erwerbsregel)
"Anyone who doesn't fight for his own self-interest has volunteered to fight for someone else's."
(The Cynic's book of wisdom)
Mein Blog
#47
Geschrieben 21 Juli 2009 - 14:10
#48
Geschrieben 21 Juli 2009 - 15:42
Ich sehe da zwei Probleme:Ich denke schon, dass "korrekt" oder "sorgfaeltig" ein Kriterium sein kann, sowohl in natur- als auch in geisteswissenschaftlicher Hinsicht. In der Hard-SF baut man nicht nur auf anerkannte, von Experimenten bestaetigten Theorien, sondern auch an moeglichen Modellen oder erweiterten Theorien und nimmt sie als gegeben hin, geht aber auch darueber hinaus. (Sonst waeren in der Hard-SF Fluege mit Ueberlichtgeschwindigkeit nicht moeglich.) Die Technik usw. und deren Erklaerung orientieren sich also an der (mehr oder weniger) aktuellen Forschung und extrapoliert. Soweit koennte man die Geschichte mMn als "naturwissenschaflich korrekt" oder "sorgfaeltig" bezeichnen. Hat die Geschichte ein geisteswissenschaftliches Modell oder Theorie zum Inhalt und haelt sie sich an den davon gegebenen Rahmen - mit moeglichen Extrapolationen -, kann man sie dann nicht mit einiger Berechtigung als "geisteswissenschaflich korrekt" oder "sorgfaeltig" bezeichnen. Den Unterschied, den ich sehe, ist, dass es schwieriger bis unmoeglich ist, die Modelle und Theorein in der Geisteswissenschaft, so experimentell zu belegen/ untermauern, wie es in der Naturwissenschaft moeglich ist.
- Einerseits wird hier ein qualitatives Kriterium zur Gattungseinteilung herangezogen. Hard SF bemüht sich zweifellos um naturwissenschaftliche Korrektheit (bis zu einem gewissen Grad); ABER: Wenn einem Hard-SF-Autor ein Schnitzer unterläuft, fliegt der entsprechende Roman deshalb nicht aus dem Genre. Er mag als schlechte Hard SF gelten, ist aber immer noch Hard SF. Das Kriterium ist also nicht die tatsächliche Sorgfalt oder Richtigkeit, sondern die angestrebte (was in meinen Augen ein markanter Unterschied ist).
- Andererseits gibt es zahlreiche SF-Romane, die zwar von geisteswissenschaftlichen Theorien inspiriert sind, die aber keinen Moment Anspruch auf «wissenschaftliche Korrektheit» beanspruchen. Man nehme nur Nineteen-Eightyfour und A Clockwork Orange. Beide gehen von bestimmten Modellen aus (bei Orwell etwa zum Verhältnis von Sprache und Weltbild, bei Burgess behaviouristische Psychologie), führen sie aber in einer Weise weiter, die wohl kaum jemand als «wissenschaftlich korrekt» bezeichnen würde. Das ist auch gar kein Problem, da sie ja primär einen literarischen und nicht einen wissenschaftlichen Anspruch haben.
Mich würden Beispiele interessieren, die Du als "geisteswissenschaftlich korrekt" bezeichnen würdest. Ich bringe noch einmal das Beispiel von Walden Two, da mir dieses als sehr prägnant erscheint. Skinner hat hier eine Utopie auf der Basis seines eigenen behaviouristischen Modells entwickelt. Einerseits bin ich keineswegs sicher, ob er diese tatsächlich für umsetzbar/realistisch/plausibel/wissenschaftlich korrekt hielt, oder ob er primär seine eigenen Theorien literarisch weitertreiben wollte (wahrscheinlich war's irgendwo dazwischen), zum anderen gab und gibt es genug Psychologen, die Skinners Ansatz grundsätzlich für verfehlt halten. Skinner hatte beispielsweise von Anfang mit massiver Kritik von Seiten der Psychoanalyse zu kämpfen, und auf dem Gebiet des Spracherwerbs wurde sein Stimulus-Response-Modell von Chomsky und Co. ebenfalls heftig angegriffen und teilweise auch klar widerlegt. Wir haben hier also ein Werk einer geisteswissenschaftlichen Kapazität, deren Theorien aber immer umstritten waren. Ist das nun «geisteswissenschaftlich korrekt»?
Bearbeitet von simifilm, 21 Juli 2009 - 15:45.
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#49
Geschrieben 21 Juli 2009 - 16:15
In der Tat - unter "geisteswissenschaftlich inspiriert" würde ich was ganz anderes verstehen als unter "geisteswissenschaftlich richtig". Unter Letzterem eigentlich in erster Linie, dass das, was an nicht-naturwissenschaftlichen Zusammenhängen vorkommt, auch genauso korrekt recherchiert ist wie die Technik - nicht unbedingt, dass diese nicht-naturwissenschaftlichen Zusammenhänge im Mittelpunkt stehen.Keine Frage, aber das hat wiederum wenig mit den Romanen zu tun - siehe mein Delany-Beispiel. Babel 17 ist definitiv stark von der Linguistik beeinflusst und ist "streng geisteswissenschaftlich, sprich: linguistisch, gesehen" dennoch Unsinn. Dennoch würde der Roman wohl in die Kategorie fallen, die hier gemeint sein soll. Genau deshalb finde ich ja, dass «geisteswissenschaftlich richtig» eine untaugliche Kategorie ist. «Von geisteswissenschaftlichen Theorien inspiriert» trifft es eher; das geht dann in die Richtung von TrashStars «Werke mit philosophischem Hintergrund».
"Geisteswissenschaftlich inspiriert" wäre hingegen alles, wo diese Themen im Mittelpunkt stehen, egal wie blödsinnig sie ausgeführt sind. Ich weiß nicht, was das sinnvollere Kriterium wäre - ich weiß nur, die fehlerhaften Darstellungen regen mich mehr auf als das völlige Fehlen solcher Fragen. Insofern wäre "geisteswissenschaftlich richtig" für mich auf jeden die wichtigere Aussage.
#50
Geschrieben 21 Juli 2009 - 16:20
Das Letztere scheint mir ein Qualitätskriterium zu sein (wenn auch nur ein mässig sinnvolles), und wenn Du Qualitätskriterien mit Genredefinitionen verknüpfst, kriegst Du schnell ein Problem. Was geschieht dann mit schlechten Büchern? Bilden die dann jeweils ein eigenes Genre? So dass wir dann jeweils zwei Genres haben: «Genre XY» und «schlecht gemachtes Genre XY».In der Tat - unter "geisteswissenschaftlich inspiriert" würde ich was ganz anderes verstehen als unter "geisteswissenschaftlich richtig". Unter Letzterem eigentlich in erster Linie, dass das, was an nicht-naturwissenschaftlichen Zusammenhängen vorkommt, auch genauso korrekt recherchiert ist wie die Technik - nicht unbedingt, dass diese nicht-naturwissenschaftlichen Zusammenhänge im Mittelpunkt stehen. "Geisteswissenschaftlich inspiriert" wäre hingegen alles, wo diese Themen im Mittelpunkt stehen, egal wie blödsinnig sie ausgeführt sind. Ich weiß nicht, was das sinnvollere Kriterium wäre - ich weiß nur, die fehlerhaften Darstellungen regen mich mehr auf als das völlige Fehlen solcher Fragen. Insofern wäre "geisteswissenschaftlich richtig" für mich auf jeden die wichtigere Aussage.
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#51
Geschrieben 21 Juli 2009 - 16:53
#52
Geschrieben 21 Juli 2009 - 16:58
- Ein (das?) zentrale Thema des Romans (und des Films) ist der freie Wille. Ist der Mensch noch ein Mensch, wenn er sich nicht mehr frei - zum Guten oder Bösen - entscheiden kann. Das ist eine fundamentale philosophische und auch theologische Frage.
- Des Weiteren wird der Hauptfigur ein Art pavlovscher Anti-Gewalt-Reflex antrainiert. Hier steht klar ein behauvoristisches Modell der menschlichen Psyche im Hintergrund.
- Drittens ist der Roman sprachlich sehr prägnant geschrieben. Gemäss Burgess soll der Leser damit einer Art Gehirnwäsche unterzogen werden und so die Welt durch die Augen des Protagonisten. Diese Überlegung basiert auf einem bestimmten Verständnis des Zusammenhangs von Sprache und Weltbild.
Wir haben hier also drei unterschiedliche Themenfelder - wahrscheinlich gibt es noch mehr -: Philosophie/Theologie, Psychologie und Sprache/Konstruktivismus. Dass dieser Roman stark durch gewisse geisteswissenschaftliche Theorien und Traditionen inspiriert wurde, steht wohl ausser Frage. Dass er gewisse Fragen aus diesen Traditionen aufwirft, ist wohl ebenfalls klar. Aber inwiefern ist er «korrekt»? Burgess selbst hat zur Frage des freien Willens eine klare Meinung und die kommt im Roman wohl auch durch. Aber ist die «korrekt»? Ich kann sie teilen oder nicht, aber das war's dann auch schon. - Zu den nächsten zwei Punkten: Burgess spinnt hier gewisse bestehende Theorien weiter, tut er das korrekt? Kann man jemandem auf diese Art Gewalt abtrainieren? Keine Ahnung, ich denke aber, dass das nicht geht. Und schliesslich die Gehirnwäsche-Geschichte - die halte ich für grundlegend falsch.
Ist A Clockwork Orange geisteswissenschaftlich korrekt oder nicht? Und was sagt das über eine allfällige Genreeinteilung aus?
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#53
Geschrieben 21 Juli 2009 - 17:01
Da hast du natürlich recht - allerdings ist die Gleichgültigkeit gegenüber nicht-technischen Details schon oft eine Art Dauermerkmal einer gewissen Art SF und schrammt dabei nahe an einem Genremerkmal vorbei. Bei den meisten Büchern, die mir da unangenehm aufgefallen sind, würd ich nicht mal sagen, dass sie wirklich "schlecht" sind - es ist halt mehr eine systematische Vernachlässigung gewisser Aspekte. "Geisteswissenschaftlich korrekte" SF wäre für mich dann solche, die nicht-technische Zusammenhänge eben nicht vernachlässigt. Das muss nicht heißen, dass sie diese dann in den Mittelpunkt stellt. Nur dass sie kein deutlich sichtbares "Egal-Etikett" aufklebt, wann immer diese Dinge berührt werden. Die Abgrenzung zwischen Qualitätsmerkmal und Subgenreeigenschaft finde ich gerade in dem Bereich oft besonders schwierig.Bilden die dann jeweils ein eigenes Genre? So dass wir dann jeweils zwei Genres haben: «Genre XY» und «schlecht gemachtes Genre XY».
#54
Geschrieben 21 Juli 2009 - 17:08
Nun, nach meinen Vorstellungen wäre er "geisteswissenschaftlich korrekt" - denn er ist nicht "geisteswissenschaftlich dumm", wie richtig oder falsch die dargestellten Zusammenhänge auch sein mögen. Es gibt in dem Roman keine "Blindheit" gegenüber dem Thema.Ist A Clockwork Orange geisteswissenschaftlich korrekt oder nicht? Und was sagt das über eine allfällige Genreeinteilung aus?
Ich denke, eine gewisse Spielerei mit Modellen sollte in der Literatur ja grundsätzlich erlaubt sein - sogar mit Modellen, die in der Wirklichkeit überholt sind. Für mich lege der entscheidende Faktor in dem, was ich oben angesprochen habe - in dem Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Theorie, einem ausgearbeiteten, in sich kohärentem Modell - und offensichtlichem, unkohärentem Blödsinn, der weder mit der Wirklichkeit noch mit einem Modell etwas zu tun hat.
#55
Geschrieben 22 Juli 2009 - 11:32
http://www.scifinet....?showtopic=8598
Bearbeitet von Matthias, 22 Juli 2009 - 11:33.
#56
Geschrieben 22 Juli 2009 - 12:15
Herausgeber Future Fiction Magazine (deutsche Ausgabe) ||| Aktuelles Buch: KI - KOMISCHE INTELLIGENZ (mit Uwe Hermann) ||| edition-übermorgen.de ||| uwepost.de ||| deutsche-science-fiction.de
#57
Geschrieben 22 Juli 2009 - 12:17
Auch «speculative fiction» ist ein Begriff, der in diesem Kontext gerne verwendet wird (auch wenn manche darin schon wieder einen Überbegriff sehen).Vielleicht hätte man einfach "Social Fiction" als Subgenre hinschreiben sollen. Mir war bis vorhin ehrlich gesagt der Begriff "Soft SF" gar keiner. Also, kein Begriff. Aber man lernt ja gerne dazu
Signatures sagen nie die Wahrheit.
Filmkritiken und anderes gibt es auf simifilm.ch.
Gedanken rund um Utopie und Film gibt's auf utopia2016.ch.
Alles Wissenswerte zur Utopie im nichtfiktionalen Film gibt es in diesem Buch, alles zum SF-Film in diesem Buch und alles zur literarischen Phantastik in diesem.
- • (Buch) gerade am lesen:Samuel Butler: «Erewhon»
- • (Buch) als nächstes geplant:Samuel Butler: «Erewhon Revisited»
-
• (Film) gerade gesehen: «Suicide Squad»
-
• (Film) Neuerwerbung: Filme schaut man im Kino!
#58
Geschrieben 22 Juli 2009 - 13:31
#59
Geschrieben 22 Juli 2009 - 14:44
Herausgeber Future Fiction Magazine (deutsche Ausgabe) ||| Aktuelles Buch: KI - KOMISCHE INTELLIGENZ (mit Uwe Hermann) ||| edition-übermorgen.de ||| uwepost.de ||| deutsche-science-fiction.de
#60
Geschrieben 22 Juli 2009 - 16:28
Wer mal reinschauen will: http://www.goodreads.com/
Besucher die dieses Thema lesen: 0
Mitglieder: 0, Gäste: 0, unsichtbare Mitglieder: 0


 Dieses Thema ist geschlossen
Dieses Thema ist geschlossen









