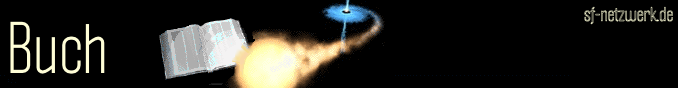Der Kapitän/Ich-Erzähler und seine Crew waren mit der Medusa Richtung Persischer Golf unterwegs, um Plutonium zu schmuggeln, das sie im Batteriefach hinter dem Pilotensitz in einem Tiefsee-U-Boot namens Triton versteckt hatten, das ein Team von Forschern gemietet hat. Wozu das Plutonium gedacht war und für wen bleibt offen. Militärische Zwecke und übliche Verdächtige wie der Iran, den Joshua auch aus eigener Anschauung aus einer recht belastenden Perspektive kennengelernt hat, liegen zwar auf der Hand, bleiben aber diffuse Hypothesen. Der Iran wäre z.B. schon heute durchaus in der Lage, mit seinen Kernreaktoren waffenfähiges Plutonium selbst zu erzeugen. Das ist aber zweitrangig. Wichtiger ist, dass der Kapitän einen Umweg nimmt, der über die tiefste Stelle des Nordaustralischen Beckens führt, dem Berlintief, und zwar aufgrund eines Funksignals, das der Empfänger des Tauchbootes seit Tagen empfängt, genau aus diesem Tief. Erst seit Tagen. Die Expedition war also nicht auf die Erkundung des Berlintiefs samt Funkquelle ausgelegt, denn solche Projekte brauchen einen längeren Vorlauf. Was das Signal genau beinhaltet, erfahren wir nicht. Nur, dass es den Kapitän dorthin gelockt, also irgendwie einen bedeutsamen Anreiz geboten haben muss, und zwar noch bevor die geheimnisvolle stachelige Kugel sich geostationär über dieses Gebiet platziert hat.
Der Kapitän und seine Komplizin Umah rechnen im Fall eines vorgezogenen Tauchgangs mit Fragen seitens der Wissenschaftler, was zusammen mit der Sturmtieflüge bedeutet: Die Forscher wissen nichts vom Locksignal, was unplausibel ist, da ein Testtauchgang für den folgenden Tag geplant war und die Forscher deshalb ausgiebige Vorbereitungen am Tiefsee-U-Boot und somit auch an dessen Empfänger vorgenommen haben dürften, zumal der vorgesehene Pilot des Bootes einer von ihnen war. Den Umweg über das Berlintief habe der Kapitän ihnen mit der Umgehung einer Sturmfront begründet, als ob Meeresforscher nicht in der Lage wären, die meteorologische Situation über eigene Quellen zu klären.
Die Spannung der Geschichte ist ganz auf die bevorstehende Entdeckung ausgerichtet, zu der es dann etwa zur Mitte des Textes kommt. Bis dahin gibt es wenig Leseanreize und keine rechte Wendung. Der Text versucht die Neugier zum Teil etwas plakativ mit sechs anführungszeichenreichen Andeutungen in nur zwei Spalten zu nähren (ab Seite 6: „Nur, bis ich herausgefunden habe, was …“; „Wenn die an Bord kommen, sind wir erledigt“; „Es war nie geplant dass du …“; „Unser Versteck auf der Triton, es …“; „Du hast schon einmal mehr verloren als …“; „Das wissen wir doch gar nicht. Du …“). Die Tauchfahrt verläuft komplikationslos und da solche Fahrten in den heutigen Medien (und in der SF) nicht ganz neu sind, bietet sie auch wenig Überraschungen. Die Begegnung selbst entfaltet sich im Wesentlichen als Dialog, wobei es zu einer Wendung kommt, als plötzlich die Vernichtung der Erde in Aussicht steht, eine Gefahr, die aber sogleich entschärft wird. Der Rest ist eine von Gleichnissen durchzogene Unterhaltung zwischen Lehrer und Schüler, wie wir sie aus vielen spirituell-philosophisch orientierten Settings kennen, emotionsarm, mit allen losen Fäden und Unschärfen. Hier blieb die Chance ungenutzt, ein interessantes Konzept auf neue, eindrückliche Weise dem Publikum nahe zu bringen.
Das Wesen in der Meerestiefe erklärt, die stachelige Kugel sei eine Sonde, die wegen ihm gekommen sei. Sie werde die Erde vernichten, wenn sie das Rechenstratum des im Berlintief gestrandeten UFOs ausliest, weil sie die Menschen für eine hochgefährliche Zivilisation halte. Das Rechenstratum ist wohl ein Neologismus und bedeutet letztlich Rechenschicht, was wohl eine weniger profane Bezeichnung für so etwas wie einen Rechner sein soll. Der Dialog ist nicht eindeutig in Bezug auf die Aussagen des Wesens, aber es scheint, als wolle es das Auslesen seines Rechenstratums und damit auch die Vernichtung der Erde verhindern. Warum, das wird leider nicht deutlich. Eine naheliegende Motivation könnte sich aus dem spirituellen Konzept selbst ableiten lassen. Da das UFO zu stark beschädigt ist, um das Problem durch Kommunikation mit der Sonde zu lösen, strebt das Wesen offenbar die Selbstzerstörung an, wobei auch der Erzähler zu Tode kommen wird. Zu diesem Zweck scheint es den Kapitän samt U-Boot und Plutonium angelockt zu haben. Es will wohl eine Art Atombombe zünden. Einen einfacheren Weg, die Daten im Rechenstratum zu zerstören, gibt es nicht? Das ist erklärungsbedürftig, zumal hierfür 2.600 Jahre zur Verfügung standen. Und erst im letzten Moment, kurz bevor die Sonde erscheint, fällt dem Wesen am Meeresboden die Plutoniumlösung ein?
Bevor es zur Explosion kommt, will das Wesen, das wohl nicht zufällig göttliche Konnotationen erhält („Ich hatte viele Namen“ (Seite 13) und „Ich bin, was ich bin“ (Seite 15)) dem Kapitän etwas schenken. Wie sich herausstellt, soll es sich um eine Erkenntnis handeln, die dabei helfen soll, die Angst des Kapitäns vor seinem Tod zu überwinden, und, wie wir am Ende erfahren, auch um eine Sehnsucht zu stillen, die ihn seit jeher begleitet. Es geht darum, die Vorstellung eines unabhängig existierenden Ichs zugunsten eines überdauernden Bewusstseins loszulassen, das zu einer Art Ozean gehört, auf dem einzelne Existenzen / Ich-Instanzen lediglich vorübergehende Wellen darstellen, so ähnlich wie im buddhistischen Glauben. Diese Vorstellung wird öfter mit der heutigen naturwissenschaftlichen Annahme gestützt, alles bestehe letztlich aus Elementarteilchen und Energie, die ja auch Welleneigenschaften haben. Da unser Bewusstsein offenbar irgendwie emergent hieraus hervorgeht, liegt dieser Brückenschlag zu den Naturwissenschaften nahe, zumal solche Querbezüge zwischen spirituellen Ideen und physikalischen Modellen beliebt sind. Allerdings frage ich mich, inwiefern hiermit eine optimistische Zukunftsvision verbunden ist.
Der Kapitän habe sein Leben lang vergeblich versucht, einen Horizont zu erreichen. Er wird als Draufgänger („Nicht, weil ich bei der kleinsten Schwierigkeit den Schwanz einziehe“, Seite 7) und Prädator („wenn du etwas willst, musst du es dir nehmen“, Seite 7) dargestellt. Irgendwie scheint all das zum Tod einer von ihm geliebten Frau geführt zu haben. Wie genau wird leider nicht deutlich. Diese Frau soll ihm im Sterben eine Kette geschenkt haben. An ihr hingen die chinesischen Zeichen für das Wort Buddha (der Erwachte), was wörtlich auf Chinesisch „nicht Mensch“ bedeuten soll. Vielleicht wollte sie ihm damit einen Hinweis, eine Hilfestellung für seine Weiterentwicklung geben? Der Kapitän soll jedenfalls schon immer auf der Suche gewesen sein, die nun im Berlintief endet. Der Zusammenhang zwischen seiner Jagd nach dem Horizont, dem spirituellen Thema am Schluss und den dargestellten Eigenschaften des Kapitäns bleibt diffus. Ging es ihm um Abenteuer, um Selbstbestätigung, um Profit, um Trost, um spirituelle Erlösung oder gar alles zusammen? Die Figurenzeichnung und ihr zentrales Motiv bräuchten hier mehr Schärfe.
Hinzu kommt, dass der Vergleich mit dem Streben nach dem Horizont nicht ganz passt. Den Horizont erreichen wir deshalb nie, weil er sich eins zu eins mit unserer eigenen Bewegung verschiebt. So wie beim Regenbogen verschiebt sich die physikalische Fläche, aus der die Lichtreflektion kommt, mit unserem Standort. Es ist also nicht richtig, wie es am Schluss heißt, dass der Kapitän den Horizont nicht erreichen konnte, weil er der Horizont war, auch nicht in einem übertragenen Sinn. Es ist eher so, dass er als Welle nicht fürchten brauchte zu vergehen, weil er nach wie vor das Wasser im Ozean blieb. Das sind zwei Analogien durcheinandergekommen.
Ich hätte es passend gefunden, wenn der Verlust der geliebten Frau mich als Leser berührt hätte, doch ich weiß nichts über sie oder über die Beziehung zwischen ihr und dem Kapitän. Ich erfahre nichts über die Bedeutung, die sie für ihn hatte. Die Drohung „Vorsicht“ und der schmerzhafte Stich ins Herz sind ja eher Klischees und recht unspezifisch. Er soll sie durch sein getriebenes, rücksichtsloses Vorgehen verloren haben, doch sein Verhalten in der Szene zeigt, dass er daraus nichts gelernt hat. Auch das lädt nicht dazu ein, stellvertretend mit ihm zu trauern. Dieser Stelle fehlt es deshalb an dramaturgischer Kraft.
Der Ich-Erzähler berichtet im Präsens. Üblicherweise bedeutet das, er erzählt, während die Dinge geschehen. Tatsächlich hört sein Bericht auch dort auf, wo er stirbt. Während der Erzählung kommt es jedoch zu Vorwegnahmen über die Zukunft:
Seite 10: „‚Da!‘, entfährt es mir später …“ und „Einige Minuten später …“
Handelt es sich also um historisches Präsens? Dann müsste es im Präteritum eingebettet sein, was nicht der Fall ist. Es würde auch die Frage aufwerfen, woher der Bericht kommt, denn die Person ist ja verstorben und hat nichts hinterlassen. Hier haben wir also eine gewisse Inkonsistenz.
Auf Seite 11 sagt der Kapitän, er sei Janus Wakefield. Dieser Name sagt mir nichts. Sollte ich nicht einer der wenigen in der Zielgruppe sein, dem es so geht, wäre es gut gewesen, hier expliziter zu werden.
Die Entität aus dem UFO hat einen Habitus, der aus einer „fremdartigen Flüssigkeit, die auf unnatürliche Weise in Form gehalten wird“ besteht. Sie erinnert an flüssigen Obsidian, wie die Wellen im Nordaustralischen Becken, besteht also möglicherweise aus Meerwasser. Es ist ähnlich wie bei der Vorhut der intelligenten Tiefseebewohner aus dem Film The Abyss von James Cameron, als sie sich Einblick in eine Tiefseestation verschaffen. In solchen Fällen wünsche ich mir immer eigene, neue Einfälle der Autori.