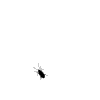Du kannst ja bei Erfolg eine Paperbackausgabe für das gemeine Volk nachschiebenKlar EDFC, aber nicht in der üblichen Aufmachung, sondern als Hardcover, Leinen, mit Innen-Illustrationen von Björn Lensig und einem exklusiven Cover (ist noch in Arbeit). Wegen der vermutlich überschaubaren Nachfrage ist die Ausgabe auf hundert numerierte Exemplare limitiert. Also ein Ego-Trip in Reinkultur ...
VISIONEN 4
#151
Geschrieben 21 Oktober 2007 - 11:15
"Alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, für Geld getan zu werden."
(13. Erwerbsregel)
"Anyone who doesn't fight for his own self-interest has volunteered to fight for someone else's."
(The Cynic's book of wisdom)
Mein Blog
#152 Gast_Frank W. Haubold_*
Geschrieben 21 Oktober 2007 - 11:26
Seut wann nagen denn Privatdozenten und Raumschlachtexperten am Hungertuch?Du kannst ja bei Erfolg eine Paperbackausgabe für das gemeine Volk nachschieben
#153
Geschrieben 21 Oktober 2007 - 11:31
Denk dran, Privatdozenten sind Professoren ohne Professur, und Raumschlachten werden, wie wir mittlerweile wissen, nur von durchgängig leicht verblödeten Konsumenten des intellektuellen Prekariats gelesen, die meist ja auch nicht viel Geld habenSeut wann nagen denn Privatdozenten und Raumschlachtexperten am Hungertuch?
"Alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, für Geld getan zu werden."
(13. Erwerbsregel)
"Anyone who doesn't fight for his own self-interest has volunteered to fight for someone else's."
(The Cynic's book of wisdom)
Mein Blog
#154 Gast_Frank W. Haubold_*
Geschrieben 21 Oktober 2007 - 11:41
Ist das nicht die gleiche Klientel, die die Stütze für Premiere-Abos ausgibt? Da ist der Absatz doch garantiert. Anders als bei hyperintellektuellen E-Literatur-Liebhabern, die in ihren Elfenbeintürmen so hoch über den Wolken schweben, daß sie die Sphäre profaner Geld-Ware-Tauschgeschäfte längst hinter sich gelassen haben ...Denk dran, Privatdozenten sind Professoren ohne Professur, und Raumschlachten werden, wie wir mittlerweile wissen, nur von durchgängig leicht verblödeten Konsumenten des intellektuellen Prekariats gelesen, die meist ja auch nicht viel Geld haben
#155
Geschrieben 21 Oktober 2007 - 11:44
Aber die LESEN dann doch nix mehr. Vielleicht sollte ich gleich Drehbücher schreiben...Ist das nicht die gleiche Klientel, die die Stütze für Premiere-Abos ausgibt? Da ist der Absatz doch garantiert.
Das ist wahr. Also wäre es doch das Beste, wenn Ihr Eure Werke gleich verschenkt, denn es geht doch um Kunst, um der Kunst willen. Nun seid mal konsequent!Anders als bei hyperintellektuellen E-Literatur-Liebhabern, die in ihren Elfenbeintürmen so hoch über den Wolken schweben, daß sie die Sphäre profaner Geld-Ware-Tauschgeschäfte längst hinter sich gelassen haben ...
"Alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, für Geld getan zu werden."
(13. Erwerbsregel)
"Anyone who doesn't fight for his own self-interest has volunteered to fight for someone else's."
(The Cynic's book of wisdom)
Mein Blog
#156 Gast_Frank W. Haubold_*
Geschrieben 21 Oktober 2007 - 11:59
Kein Problem, wenn sich Druckereien, Buchhändler und die Post der Aktion anschließen, könnte das Projekt mit einer schwarzen Null abgeschlossen werden. Wieso denn Drehbücher? Du könnstest die Tentakel doch auch als Sammel-Comic herausgeben. Für jede Kiste Oettinger ein Bild ... Die Vergütung erfolgt dann über die Brauerei.Aber die LESEN dann doch nix mehr. Vielleicht sollte ich gleich Drehbücher schreiben... Das ist wahr. Also wäre es doch das Beste, wenn Ihr Eure Werke gleich verschenkt, denn es geht doch um Kunst, um der Kunst willen. Nun seid mal konsequent!
Bearbeitet von Frank W. Haubold, 21 Oktober 2007 - 11:59.
#157 Gast_Frank W. Haubold_*
Geschrieben 21 Oktober 2007 - 18:28
Du hast sicher recht, aber selbst fern von jeder persönlichen Betroffenheit oder Eitelkeit ist es doch wohl ein objektiver Tatbestand, daß Publikationen wie Visionen, NOVA oder die Wurdack-Bände innerhalb einer äußerst überschauberen Szene agieren und das Ziel verfehlen, einen signifikant breiteren Leserkreis anzusprechen bzw. zu gewinnen.@ Frank
Ich kann nachvollziehen, dass es frustrierend ist, wenn nur wenige Rückmeldungen kommen oder wenn sie nicht so ausfallen wie erhofft. Für deine Story hast du aber, soweit ich es verfolgt habe, einige Meinungen erhalten, und die waren doch weitgehend positiv, oder? Und für Rezensionen in den einschlägigen Rezi-Medien ist es schlicht noch zu früh, denke ich. Das Buch ist ja noch nicht soo lang draußen.
Wenn du sagst, Die Tänzerin sei "zum Heulen schön", dann ist das deine Empfindung aus dem Schreibprozess heraus und die Empfindung, die du vermutlich beim Leser auslösen wolltest. Aber jeder empfindet anders, legt was anderes in das hinein, was er gelesen hat, und mancher bleibt vielleicht an ganz anderen Aspekten oder Kleinigkeiten hängen, die ihm den Blick auf das, was dir an der Story wichtig ist, ein wenig versperren.
Die Folge dieser Beschränkung auf eine gleichbleibende Zielgruppe mit einem Dutzend auch immer gleich agierender Rezensenten (womit ich deren Engagement nicht kleinreden möchte) ist eine gewisse Vorhersehbarkeit. Aus einer Herausforderung wird so Gewöhnung und am Ende Überdruß, nicht nur bei den Autoren, sondern auch bei den Lesern, die in eigentlich zu kurzen Abständen mit Geschichten von Iwoleit, Küper, Eckhardt oder meinethalben auch Haubold übersättigt werden. Es ist ein Mikrokosmos, in dem beinahe jeder jeden kennt und man zumeist darauf achtet, sich gegenseitig nicht weh zu tun. Wir drehen uns im Kreis, auch künstlerisch, da es keine wirklichen Herausforderungen mehr gibt, denn es gibt auch keinen Ort/Verlag, bei dem man einen SF-Text publizieren könnte, der andere Leserschichten mit vielleicht anderen Vorlieben erreicht. Deshalb und nur deshalb habe ich darüber nachgedacht, ob es nicht Zeit ist, etwas anderes zu machen, nicht das bereits mehrfach Gesagte ein weiteres Mal wiederzukäuen, sondern z. B. dem Kellerkind "deutschsprachige Phantastik" (nicht Fantasy) ein paar neue Aspekte abzugewinnen.
Das ist keine "SF-Leserschelte", wie es manchnal dargestellt wird, sondern Resultat einer Entwicklung.
Gruß
Frank
#158
Geschrieben 21 Oktober 2007 - 18:38
Überlicht und Beamen wird von Elfen verhindert.
Moderator im Unterforum Fantasyguide
Fantasyguide
Saramee
Montbron-Blog
- • (Buch) gerade am lesen:Ursula K. Le Guin – Lavinia
#159
Geschrieben 21 Oktober 2007 - 19:24
Ja, leider - aber es muss ja nicht so bleiben. In Stein gemeißelt ist es noch nicht, denke ich.Du hast sicher recht, aber selbst fern von jeder persönlichen Betroffenheit oder Eitelkeit ist es doch wohl ein objektiver Tatbestand, daß Publikationen wie Visionen, NOVA oder die Wurdack-Bände innerhalb einer äußerst überschauberen Szene agieren und das Ziel verfehlen, einen signifikant breiteren Leserkreis anzusprechen bzw. zu gewinnen.
Dagegen ist auch absolut nichts einzuwenden, ganz im Gegenteil. Ich hab es nicht so mit engen Genregrenzen und kann deshalb z.B. auch den EDFC-Jahresanthos sehr viel abgewinnen. Und sich als Leser wie als Autor nicht auf ein Genre festzulegen halte ich eh für eine gute Sache, um nicht irgendwann mal tatsächlich nur noch in eingefahrenen Bahnen festzustecken. Eine stärkere Hinwendung zu einem anderen Bereich heißt ja auch nicht, dass man sich von einem anderen gleich ganz und für immer abwendet - aber ich denke, das machst du eh nicht. Bei den Jahresanthos z.B. ist SF ein Bestandteil, der nicht dominieren, aber auch nicht fehlen sollte.Wir drehen uns im Kreis, auch künstlerisch, da es keine wirklichen Herausforderungen mehr gibt, denn es gibt auch keinen Ort/Verlag, bei dem man einen SF-Text publizieren könnte, der andere Leserschichten mit vielleicht anderen Vorlieben erreicht. Deshalb und nur deshalb habe ich darüber nachgedacht, ob es nicht Zeit ist, etwas anderes zu machen, nicht das bereits mehrfach Gesagte ein weiteres Mal wiederzukäuen, sondern z. B. dem Kellerkind "deutschsprachige Phantastik" (nicht Fantasy) ein paar neue Aspekte abzugewinnen.
Mein Blog: Schreibkram & Bücherwelten
#160 Gast_Frank W. Haubold_*
Geschrieben 21 Oktober 2007 - 21:00
Dann muß ich das nicht übernehmen ...Zu den üblichen Verdächtigen, ich hab auch rezensiert: http://www.fantasyguide.de/5074.0.html Helmuth hat mir seine Meinung schon gegeigt.
#161
Geschrieben 21 Oktober 2007 - 21:53
Überlicht und Beamen wird von Elfen verhindert.
Moderator im Unterforum Fantasyguide
Fantasyguide
Saramee
Montbron-Blog
- • (Buch) gerade am lesen:Ursula K. Le Guin – Lavinia
#162
Geschrieben 22 Oktober 2007 - 08:57
Bearbeitet von ShockWaveRider, 22 Oktober 2007 - 09:55.
Verwarnungscounter: 2 (klick!, klick!)
ShockWaveRiders Kritiken aus München
möchten viele Autor'n übertünchen.
Denn er tut sich verbitten
Aliens, UFOs und Titten -
einen Kerl wie den sollte man lynchen!
- • (Buch) gerade am lesen:D. Mitchell "Der Wolkenatlas"
#163 Gast_Frank W. Haubold_*
Geschrieben 24 Oktober 2007 - 06:20
Das ist dann auch wieder eines jener Statements, zu denen mir nichts mehr einfällt ... Eine neue, wie stets ein wenig selbstgewisse Besprechung von Thomas Harbach zu den Visionen 4 ist auf SF-Radio erschienen. Na ja ... Gruß FrankBei Hoeses "Hyberbreed" und Haubolds "Die Tänzerin" habe ich schlicht und einfach nicht kapiert, worum es ging.
Bearbeitet von Frank W. Haubold, 24 Oktober 2007 - 10:33.
#164
Geschrieben 25 Oktober 2007 - 10:17
Warum schreibst Du dann überhaupt etwas dazu?Das ist dann auch wieder eines jener Statements, zu denen mir nichts mehr einfällt ...
Verwarnungscounter: 2 (klick!, klick!)
ShockWaveRiders Kritiken aus München
möchten viele Autor'n übertünchen.
Denn er tut sich verbitten
Aliens, UFOs und Titten -
einen Kerl wie den sollte man lynchen!
- • (Buch) gerade am lesen:D. Mitchell "Der Wolkenatlas"
#165 Gast_Frank W. Haubold_*
Geschrieben 25 Oktober 2007 - 10:50
Deshalb: Wenn eine Protagonistin von A über B nach C gelangt (ohne Metaebenen und Subtexte), müßte das Geschehen m. E. durchaus zu überschauen sein ... Gruß Frank alias "die Leberwurst"Warum schreibst Du dann überhaupt etwas dazu?
Gruß Ralf
Bearbeitet von Frank W. Haubold, 27 Oktober 2007 - 08:44.
#167
Geschrieben 25 Oktober 2007 - 11:55
Hey, Dir fällt ja doch was ein!Deshalb: Wenn eine Protagonistin von A über B nach C gelangt (ohne Metaebenen und Subtexte), müßte das Geschehen m. E. durchaus zu überschauen sein ...
Verwarnungscounter: 2 (klick!, klick!)
ShockWaveRiders Kritiken aus München
möchten viele Autor'n übertünchen.
Denn er tut sich verbitten
Aliens, UFOs und Titten -
einen Kerl wie den sollte man lynchen!
- • (Buch) gerade am lesen:D. Mitchell "Der Wolkenatlas"
#168 Gast_Frank W. Haubold_*
Geschrieben 22 November 2007 - 10:11
Bearbeitet von Frank W. Haubold, 22 November 2007 - 11:00.
#169
Geschrieben 19 Dezember 2007 - 18:13
Der Lesezirkel auf SF-Fan.de ist mittlerweile eingeschlafen, darum platziere ich meine Bemerkungen zu den Stories jetzt hier. Zu Küpers Modus Dei, Asters Infogeddon und Hoeses Hyperbreed hatte ich im Lesezirkel bereits geschrieben. Jetzt geht es weiter mit:
Marcus Hammerschmitt: Die Lokomotive.
Endlich mal wieder eine Zukunftsvision, außerhalb des Cyberspace, wo immer nur die Konzerne das Sagen haben und die Technik das Menschliche zersetzt. Man mag von dem sozialistisch angehauchten System, das hier geschildert wird, halten, was man will - Marcus Hammerschmitt schafft es mal wieder, seine konstruierte Gesellschaft authentisch erscheinen zu lassen, weil darin Protagonisten agieren, deren Gefühlswelt und Handlungen literarisch so gekonnt beschrieben werden, dass sie einem einfach lebendig erscheinen müssen. Diesmal steht das Abgründige im Menschen im Vordergrund, das in der Story nicht nur auf das Schicksalhafte beschränkt bleibt, sondern eng mit den Lebensverhältnissen verwoben ist (und von ihnen zum Teil erst hervorgerufen wird). Das verwerfliche Handeln des Helden lässt die Gesellschaftsform, die dieses Handeln forciert, trotzdem irgendwie liebenswert erscheinen, weil der Held nicht Abscheu für das System empfindet, sondern seine Schwächen augenzwinkernd durchschaut. Der Rückgriff auf die Dampftechnik und die in der Realität ebenso gescheiterte Gesellschaftsform des Sozialismus im Zusammenspiel mit den eisigen Temperaturen auf Ladania, schafft ein stimmungsvolles, tristes Gesamtbild, das von auffällig menschlichen Protagonisten bevölkert wird, und den Leser, der sich darauf einlassen mag, tief in die Geschichte eintauchen lässt.
Bemerkenswert finde ich die Loyalität, die der Held am Ende der Geschichte für seine Insel und die dort herrschende Gesellschaftsform empfindet, trotz der Unbilden, die er dort hatte erleiden müssen. Die Frage nach der Heimat an das Ende einer SF-Story zu setzen, ist für einen modernen, deutschsprachigen Autor zumindest ungewöhnlich - und lädt zum Spekulieren über eventuelle, zukünftige Entwicklungen dieses Themenbereiches ein.
Bearbeitet von Jan Gardemann, 21 Dezember 2007 - 10:29.
#170
Geschrieben 21 Dezember 2007 - 10:28
Uwe Post: eDead.com
Ich mag Geschichten, in denen die einfachen, durchschnittlichen Menschen ins Zentrum gerückt werden. Das ist in dieser Story der Fall. Eines fernen Tages könnte die massenhafte elektronische Konservierung der Erinnerungen wirklich so ablaufen - jedenfalls wird das Ganze in der Geschichte technisch so fundiert und umfassend geschildert, dass ein zweites Leben unter Zuhilfenahme der konservierten Erinnerungen zumindest als möglich erscheint. Was geschieht, wenn man zuvor das Kleingedruckte nicht sorgfältig genug durchliest und nicht genug Geld zur Verfügung hat, das „Leben nach dem Tod“ einer halbwegs solide erscheinenden Firma anzuvertrauen, wird hier auf bitterböse, ironische Weise dargestellt. Nicht einmal nach dem Tod ist man vor den Mechanismen der freien Markwirtschaft sicher. Klasse Story, durchsetzt von düsterer Ironie - hat mir gut gefallen.
Thor Kunkel: Aphromorte
Der Autor liefert in seiner Story eine für seine Geschichte passende Genrebezeichnung gleich mit: Porno-Remake von Nacht der lebenden Leichen. Da ich mir medienmäßig (fast) alles reinziehe, worin Zombis vorkommen, konnte ich mich für diese Story natürlich auch begeistern. Ist aber sicherlich Geschmacksache. Auf jeden Fall eine Story ohne Jugendfreigabe.
Von dieser Vordergründigkeit mal abgesehen, ist das literarische Vorhaben, den Menschen auf den Sexualtrieb zu reduzieren, eine konsequente Überspitzung der (männlichen) Wunschvorstellungen und führt diese zugleich ad absurdum. Die Dialoge hatten hin und wieder den Anschein, sie könnten von einem Pornostreifen übernommen worden sein. Da ich Thor Kunkel als Künstler ansehe, nehme ich mal an, dass dies kein Unvermögen von seiner Seite war, sondern Absicht. Ich würde ihm recht geben: Sollten die infantilen Wunschvorstellungen (mancher) Männer die Weltherrschaft in Form einer Krankheit an sich reißen - wir wären alle dem Untergang geweiht.
Bevor ich mich dem Moloch widme, werde ich mir erst einmal ein paar Stories aus J.G. Ballards Die Stimmen der Zeit zu Gemüte führen. Ich kenne Michaels Stil und seine Vorliebe für (mich) deprimierende Szenarien. Da muss ich mich zuvor noch etwas wappnen!
Bearbeitet von Jan Gardemann, 21 Dezember 2007 - 10:30.
#171
Geschrieben 26 Dezember 2007 - 13:04
Die ersten Seiten dieses Kurzromans ließen mich befürchten, es mit einem Neuaufguss der Story Morphogenese aus dem Visionen-Band Plasma Symphonie zu tun zu haben. Dessen ungeachtet bereitete mir die Lektüre trotzdem Vergnügen, denn die Fülle an Details wob in meiner Vorstellung eine interessante Welt, die wie ein bunt zusammengesteppter Flickenteppich anmutete. Eine beachtliche intellektuelle Leistung, all die gesellschaftlichen Aspekte, die technischen Entwicklungen und die daraus resultierenden Gemeinheiten so umfassend darzustellen. Einige der verwendeten Motive sind mir zwar bereits aus Vernor Vinge Kurzgeschichten und Neal Stephensons Snow Crash bekannt, und auch bezweifle ich, dass die von diesen Autoren aufgezeigten Entwicklungen von Amerika auf Deutschland übertragbar sind - doch Michael K. Iwoleit liefert im Laufe des ersten Teils dann doch eine Begründung, warum das System der Franchise und die Privatisierung kommunaler Aufgabengebiete sich fast auf der ganzen Welt breit gemacht hat.
Im zweiten Teil des Kurzromans wird dann ziemlich schnell klar, dass Der Moloch auf ein anderes Ziel hin steuert, als Morphogenese. Ich bin dem Autor übrigens dankbar, dass er die „Aktion-Szenen“ nicht „live“ geschildert hat, sondern in Rückblicken nacherzählte. Zu dem ganzen Elend auch noch blutige Szenen geliefert zu bekommen, hätte den Roman schnell umkippen lassen und die darin enthaltene „Ästhetik der menschlichen Gemeinheiten“ zu einem unerträglichen Schaukampf herabgewürdigt.
Während bei Morphogenese am Schluss der Aspekt der Transzendenz für meinen Geschmack zu rudimentär geblieben ist (und die Geschichte wegen der fehlenden, zum Besseren sich hin entwickelnden Auflösung zu einem frustrierenden und deprimierenden Erlebnis wurde), weist Der Moloch ein lichtes, offenes Ende auf. Die Konzeption und die innere Geschlossenheit der dargestellten Welt erinnerte mich stark an Planck-Zeit, Michaels stärksten und eindrucksvollsten Geschichte (nach meinem Dafürhalten).
Eines hat Der Moloch auch gezeigt: Michael K. Iwoleit erzählt seine Geschichten mit eigener Stimme, die sich nicht immer mit herkömmlichen Erzählstrukturen deckt. Dies wiederum deckt sich jedoch mit meinen Erwartungen, die ich an SF-Stories, und insbesondere an die in den Visionen veröffentlichten Geschichten, knüpfe.
#172
Geschrieben 30 Dezember 2007 - 10:54
NOVA - Das Deutsche Magazin für Science Fiction & Spekulation
VILLA FANTASTICA - Bibliothek für fantastische Literatur

#173
Geschrieben 30 Dezember 2007 - 13:47
Naja - SF-Kurzgeschichten sind halt mein Hobby. Und es macht Spaß, sie zu verdauen.Danke, Jan, für Deine ausführlichen Kommentare! Das sind ja richtiggehende Analysen...
In diesem Sinne:
Niklas Peinecke: Imago
Eine lustige Ideengeschichte, manchmal anrührend, manchmal naiv ernst. Mir haben besonders die kleinen skurrilen Einsprengsel gefallen, mit denen Niklas die Story gewürzt hat. Die Geschichte erinnert mich an SF-Kurzprosa aus den frühen siebziger Jahren, die die Emanzipation der Menschen zum Thema hatte (z.B. die Stories von Herbert W. Franke), und von Niklas Peinecke in ein neues technisches Gewandt gekleidet wurde. Eine gelungene Replik auf die Fragen, die sich die deutschsprachige SF in den siebziger Jahren gestellt hat.
Sascha Dickel: Bio Nostalgie
Diese Story hatte mich sofort fasziniert, als ich sie im Rahmen des „What If“-Preisausschreibens das erste Mal las. Diese Faszination ist auch beim neuerlichen Lesen ungebrochen geblieben. Für mich eine Story, die auf eindrucksvolle Weise zeigt, was SF-Texte, die von der modernen Computertechnik inspiriert wurden, leisten können, wenn in ihnen die abstrakten Mechanismen von Rechenvorgängen verinnerlicht werden.
Die Story von Frank W. Haubold hebe ich mir für später auf, wenn ich Franks vor kurzem erschienen Episodenroman „Die Schatten des Mars“ lese, wo diese Story ebenfalls enthalten ist.
Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr (das Trotz der Einstellung der Visionen-Reihe hoffentlich doch noch viele gute SF-Kurzgeschichten bereithalten wird).
#174
Geschrieben 01 Januar 2008 - 16:01
Eine so aufregende Sylvesterparty, wie dieses Mal, habe ich schon lange nicht mehr erlebt!
Leicht verkatert und mit vom stundenlangen Tanzen malträtierten Muskeln, hier meine Bemerkungen zu den übrigen Visionen-Stories:
Bernhard Schneider: Methusalem
Eine Story, die mich überrascht hat. Was anfangs wie eine SF-Geschichte im kleinbürgerlichen Milieu daher kommt, entwickelt sich zu einem harten, facettenreichen Text. In meiner Zeit als Storyredakteur für „phantastisch!“ habe ich viele Stories zu Gesicht bekommen, die es nicht schafften, das kleinbürgerliche Setting, in denen sie angesiedelt waren, zu brechen oder plausibel aufzulösen. In Methusalem wächst die Handlung nicht nur über das Kleinbürgertum und die Kleinfamilie hinaus, sie lässt sie wie eine Larve hinter sich; so wie der Protagonist die Sterblichkeit überwindet, überwindet er auch die Beengungen seines früheren Lebens. Obwohl dieser Prozess mit Grausamkeit und Kaltherzigkeit einhergeht, erscheint der Protagonisten trotzdem erhaben. Ihn in seiner Unsterblichkeit als ein verwandeltes, den Sterblichen als fremd erscheinendes Wesen darzustellen, ist Bernhard Schneider sehr gut gelungen!
Heidrun Jänchen: Regenbogengrün
Sinnlich geschrieben, mit Figuren, die sich dem Leser durch ihr inneres Erleben erschließen. Dazu passend das Thema der Story: Wie Gefühle die ehrgeizigen Pläne der Wissenschaftler durchkreuzen können, weil sie von diesen in ihrem eingeschränkten Vorgehen nicht eingeplant wurden. Es geht auch um Fehlentscheidungen, die aufgrund eines wenig gefestigten Gefühlslebens getroffen werden. Konsequent auch das Ende, das nicht romantisierend daher kommt und die Gefühlswelt triumphieren lässt. Es ist ein bitteres, böses Ende, das der Geschichte nahhaltige Festigkeit verleiht.
Gefühle kommen in den SF-Stories generell oft zu kurz, Heidrun Jänchen schafft es, sie als Stilmittel gekonnt einzusetzen, bewahrt sich dabei eine wohltuende Nüchternheit, und umgeht so der Gefahr, schwülstig zu werden.
Karl Michael Armer: Prokops Dämon
Die Form des Monologs zu wählen, ist ein Experiment. Karl Michael Armer beherrscht die Stilmittel professionell, und so gerät ihm der Monolog nicht langweilig. Sein Protagonist ist jedoch ein Typ, der (wie fast alle Menschen, die zum Monologisieren neigen) einem schnell auf die Nerven geht. Seinen Zuhörern ergeht es offenbar nicht anders, warum der Erzähler in seinen Monologen hin und wieder durch Abschalten des Programms unterbrochen wird. Ein witziger Einfall, der die oftmals als belehrend empfundenen Passagen erträglich macht und die Zuhörer, die nur äußerst selten zu Wort kommen, personifiziert. Wie all die anderen „Besucher“ Prokops, so würde auch ich mich für NEIN entscheiden, wenn ich nach einem Neustart des Programms gefragt würde.
Mit Gert Prokop (1932-1994) und seinen futurologischen Kriminalgeschichten um Timothy Truckle hat diese Story offenbar nichts zu tun, wie ich zuerst dachte, als ich den Titel las.
Bearbeitet von Jan Gardemann, 01 Januar 2008 - 16:02.
#175
Geschrieben 01 Januar 2008 - 17:24
Vorsicht! Die Novelle ist in zwei Teile gesplittet - "Die Tänzerin" und "Lenas Garten", dazwischen sind Erzählungen, die nur in sehr indirektem Zusammenhang damit stehen, vorrangig dem, dass sie auf dem Mars spielen. Ich empfehle Dir, sie in einem Stück zu lesen. Viel Spass im neuen Jahr!Die Story von Frank W. Haubold hebe ich mir für später auf, wenn ich Franks vor kurzem erschienen Episodenroman „Die Schatten des Mars“ lese, wo diese Story ebenfalls enthalten ist.
NOVA - Das Deutsche Magazin für Science Fiction & Spekulation
VILLA FANTASTICA - Bibliothek für fantastische Literatur

#176
Geschrieben 16 Januar 2008 - 07:57
Traurig. Aber leider wahr.Wenn ich sehe, daß einem hochbegabten Kollegen wie Marcus Hammerschmitt der verdiente Erfolg bisher versagt geblieben ist, gestern auf dem Buchmessecon aber ein Marcus Heitz gleich drei Preise abräumt, dann fürchte ich, daß die SF- und Phantastikszene zu weiten Teilen ein Tummelplatz von dummen, ungebildeten Jungs ist, die von der Welt im Allgemeinen und der Literatur im Besonderen nichts mitbekommen haben. Eine Szene, von der man sich auf lange Sicht vielleicht wirklich distanzieren sollte, wenn man mit seiner Arbeit als Autor mehr erreichen will als eingefahrene Leseerwartungen zu bedienen.
#177
Geschrieben 16 Januar 2008 - 08:15
#178
Geschrieben 16 Januar 2008 - 12:29
Lies die Novelle in den VISIONEN, nicht die in zwei Teile "gestückelte" in "Schatten". Und lass Dich überraschen. Sie hat mit dem Mars nur ganz zum Schluss was zu tun. Ich würde also noch keine Wette darauf eingehen@Frank Ich habe die Marsschatten noch nicht gelesen und "muß" mit den VISIONEN anfangen. 10:1 daß mir "Die Tänzerin" nicht überragend gefallen wird ? Genausowenig, wie eine Mars-Story von Bradbury in einer x-beliebigen Anthologie mir gefällt. Weil der geniale Kontext fehlt.
NOVA - Das Deutsche Magazin für Science Fiction & Spekulation
VILLA FANTASTICA - Bibliothek für fantastische Literatur

#179 Gast_Frank W. Haubold_*
Geschrieben 20 Januar 2008 - 13:41
Ich habe die "Tänzerin" zwar in erster Linie für den Mars-Roman geschrieben (weil bis dahin das weibliche Element unterrepräsentiert war), dann aber doch den Eindruck gehabt, daß sie auch für sich allein stehend "funktioniert". Im Grunde halte ich sie (neben den "weißen Schmetterlingen" und dem "ewigen Lied") für eine meiner besten SF-Geschichten. Einige Leser-Reaktionen haben mich dann doch irritiert, aber das liegt wohl eher daran, daß mir die Ansichten von SF-Puristen (also Lesern, die sich auf das Genre festgelegt haben) weitgehend fremd sind. Mir ist zum Beispiel völlig schleierhaft, wie jemand "Die Heimkehr" besser finden kann als die Tänzerin.@Frank Ich habe die Marsschatten noch nicht gelesen und "muß" mit den VISIONEN anfangen. 10:1 daß mir "Die Tänzerin" nicht überragend gefallen wird ? Genausowenig, wie eine Mars-Story von Bradbury in einer x-beliebigen Anthologie mir gefällt. Weil der geniale Kontext fehlt.
Zweifellos. Nur müßtest Du Dioh etwa 10.000-fach klonen, um das Schreiben von SF-Texten zu einer wirtschaftlich sinnvollen Tätigkeit für Autoren jenseits der Perry-Rhodan-Szne zu machen.Übrigens : Ich bin "DER LESER", den alle suchen.
#180
Geschrieben 21 Januar 2008 - 13:39
Das ist der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Gruß RalfMir ist zum Beispiel völlig schleierhaft, wie jemand "Die Heimkehr" besser finden kann als die Tänzerin.
Verwarnungscounter: 2 (klick!, klick!)
ShockWaveRiders Kritiken aus München
möchten viele Autor'n übertünchen.
Denn er tut sich verbitten
Aliens, UFOs und Titten -
einen Kerl wie den sollte man lynchen!
- • (Buch) gerade am lesen:D. Mitchell "Der Wolkenatlas"
Besucher die dieses Thema lesen: 1
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0