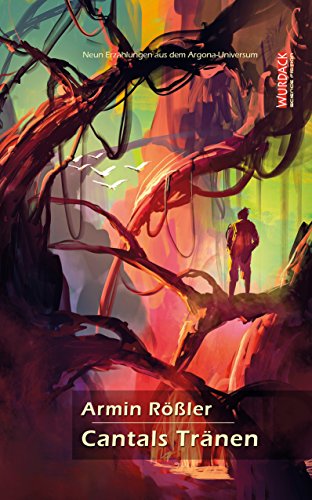Romane:
Die Nadir-Variante
Science Fiction
Wurdack Verlag, 2017
Argona
Science Fiction
Wurdack Verlag, 2008/2017
(nominiert für den Kurd Laßwitz Preis 2009)
Andrade
Science Fiction
Wurdack Verlag, 2007/2017
(nominiert für den Deutschen Science Fiction Preis und den Kurd Laßwitz Preis 2008)
Entheete
Science Fiction
Wurdack Verlag, 2006/2016
(nominiert für den Deutschen Science Fiction Preis und den Kurd Laßwitz Preis 2007)
Das vergessene Portal
Fantasy
Wurdack Verlag, 2004
(3. Platz beim Deutschen Phantastik Preis 2005)
Collection:
Tausend Stimmen
Wurdack Verlag, 2019
(in Vorbereitung)
Cantals Tränen
Wurdack Verlag, 2016
Anthologien:
Elvis hat das Gebäude verlassen
herausgegeben von Frank Hebben, André Skora und Armin Rößler
Begedia Verlag, 2019
Gamer
herausgegeben von André Skora, Armin Rößler und Frank Hebben
Begedia Verlag, 2016
Tiefraumphasen
herausgegeben von André Skora, Armin Rößler und Frank Hebben
Begedia Verlag, 2014
Emotio
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2011
Die Audienz
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2010
Molekularmusik
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2009
Lotus-Effekt
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2008
S.F.X
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2007
Lazarus
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2007
Tabula rasa
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2006
(2. Platz beim Deutschen Phantastik Preis 2007)
Golem & Goethe
herausgegeben von Armin Rößler
Wurdack Verlag, 2005
Überschuss
herausgegeben von Armin Rößler
Wurdack Verlag, 2005
(5. Platz beim Deutschen Phantastik Preis 2005)
Walfred Goreng
herausgegeben von Armin Rößler und Dieter Schmitt
Wurdack Verlag, 2004
(4. Platz beim Deutschen Phantastik Preis 2005)
Deus Ex Machina
herausgegeben von Armin Rößler und Dieter Schmitt
Story-Olympiade, 2004
Sekundärliteratur:
Carl Amerys Der Untergang der Stadt Passau. Eine Untersuchung der zentralen Themenkomplexe
EDFC, 2001
Kurzgeschichten:
Random Gunn und der Griff nach der Weltherrschaft
Elvis hat das Gebäude verlassen
herausgegeben von Frank Hebben, André Skora und Armin Rößler
Begedia Verlag, 2019
Der Große See
Armin Rößler: Cantals Tränen
Wurdack Verlag, 2016
Heimkehr
Armin Rößler: Cantals Tränen
Wurdack Verlag, 2016
Schwärzer als die Nacht, dunkler als der Tod
Armin Rößler: Cantals Tränen
Wurdack Verlag, 2016
Begegnung mit Erwin (oder: Ein Vorwort)
Uwe Sauerbrei: Erwins Reise
Verlag in Farbe und Bunt, 2016
Katar 2022
Gamer
herausgegeben von André Skora, Armin Rößler und Frank Hebben
Begedia Verlag, 2016
El Dorado
Tiefraumphasen
herausgegeben von André Skora, Armin Rößler und Frank Hebben
Begedia Verlag, 2014
Fremd
Corona Magazine 300, 2014
Feuergeister
phantastisch! 49
herausgegeben von Klaus Bollhöfener
Atlantis Verlag, 2013
Die Straße
Space Rocks
herausgegeben von Harald Giersche
Begedia Verlag, 2011
Das Versprechen
Emotio
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2011
Auf der Flucht
Corona Magazine 250, 2011 (online)
Phönix
Die Audienz
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2010
Was Ernst schon immer über Argonomen und Meurg wissen wollte
Das ist unser Ernst
herausgegeben von Martin Witzgall
Wortkuss Verlag, 2010
Entscheidung schwarz
Weltraumkrieger
herausgegeben von Dirk van den Boom und Oliver Naujoks
Atlantis Verlag, 2010
Die Fänger
Molekularmusik
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2009
Das Mädchen, das niemals lachte
Siegergeschichte des Wettbewerbs der Bürgerstiftung Kunst für Wiesloch zur Brunnengalerie
Privatdruck für die Mitglieder der Stiftung, 2008
Barbieris Flucht
Andromeda Nachrichten 223
SFCD, 2008
Online-Ausgabe (17 MB)
Martys Weg
Corona Magazine Nr. 200
Online, 2008
Das Gespinst
Lotus-Effekt
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2008
Cantals Tränen
S.F.X
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2007
Lilienthal
phantastisch! 27
herausgegeben von Klaus Bollhöfener
Verlag Achim Havemann, 2007
Lazarus
Lazarus
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2007
Sturmreiter
Die Jenseitsapotheke
herausgegeben von Frank W. Haubold
EDFC, 2006
Das Herz der Sonne
Tabula rasa
herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen
Wurdack Verlag, 2006
Die Einladung
Pandaimonion VI - Tod
herausgegeben von Ernst Wurdack
Wurdack Verlag, 2006
Der Verlorene
Rattenfänger
herausgegeben von Bernd Rothe
Blitz Verlag, 2005
Der Gravo-Dom
Golem & Goethe
herausgegeben von Armin Rößler
Wurdack Verlag, 2005
Vergnügungspark
Der ewig dunkle Traum
(Wolfgang Hohlbeins Schattenchronik Band 1)
herausgegeben von Alisha Bionda und Michael Borlik
Blitz Verlag, 2005
Barrieren
Überschuss
herausgegeben von Armin Rößler
Wurdack Verlag, 2005
Die Tränen des Blauen Gottes
Wellensang
herausgegeben von Alisha Bionda und Michael Borlik
Schreib-Lust Verlag, 2004
Eindringling
Pandaimonion IV - Das Gewächshaus
herausgegeben von Ernst Wurdack
Story-Olympiade, 2004
Faust
Deus Ex Machina
herausgegeben von Armin Rößler und Dieter Schmitt
Story-Olympiade, 2004
(6. Platz beim Deutschen Science Fiction Preis 2005)
Deus Ex Machina 'e', 2005
Corona Magazine Nr. 150, 2005
Mars
Strahlende Helden
herausgegeben von Ernst Wurdack
Story-Olympiade, 2003
Gläserne Engel
Pandaimonion III - Für Daddy
herausgegeben von Ernst Wurdack
Story-Olympiade, 2003
Sieben Gäste
Baden-Württemberg Aktuell 238
Science Fiction Club Baden-Württemberg, 2003
Menschenjäger
Future World
herausgegeben von Udo Mörsch
Go Verlag, 2003
Griff nach der Macht
Griff nach der Macht
herausgegeben von Ernst Wurdack
Story-Olympiade, 2003
Geheimnis der Höhlenwelt
Solar-Tales 11
herausgegeben von Wilko Müller jr.
Edition Solar-X, 2003
Beweisstück 84, fragmentarisch
Pandaimonion II
herausgegeben von Ernst Wurdack
Story-Olympiade, 2003
Das Land der Wolken
Francesco im Land der Delphine
herausgegeben von H.H. Dietrich und P.T. Rothmanns
Betzel Verlag, 2003
Die offene Schuld
Schwarzer Drache
herausgegeben von Udo Mörsch
Go Verlag, 2003
Schatten der Vergangenheit
Pandaimonion
herausgegeben von Ernst Wurdack
Story-Olympiade, 2002
Schöner Schein
Hexen, Magier, Scharlatane
herausgegeben von Ernst Wurdack
Story-Olympiade, 2002
Code Arche
Düstere Visionen
herausgegeben von Ernst Wurdack
Story-Olympiade, 2002
Blitz Shorties, 2003
Tausend Stimmen, längst verstummt
Welten voller Hoffnung
herausgegeben von Barbara Jung
BeJot Verlag, 2002
Das temporäre Instabilitäts-Phänomen
Solar-Tales 9
herausgegeben von Wilko Müller jr.
Edition Solar-X, 2002
Amoklauf
Groschenstory Nr. 8
2002
(nicht mehr online)
Am Ufer des Sees
Jenseits des Happy ends
herausgegeben von Barbara Jung
Go & BeJot Verlag, 2001
Nachts
Spinnen spinnen
herausgegeben von Ernst Petz und Heinrich Droege
Aarachne Verlag, 2001
Die Verschwörung
Delfine im Nebel
herausgegeben von Udo Mörsch
Go Verlag, 2001
†¦ und die Zeit steht still
Fantasia 148
herausgegeben von Franz Schröpf
EDFC, 2001
Homepage, 2002
Fließende Übergänge
Traumpfade
herausgegeben von Ernst Wurdack und Stefanie Pappon
Story-Olympiade, 2001
Homepage, 2002


 Benutzerdefiniertes Design erstellen
Benutzerdefiniertes Design erstellen