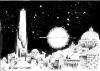Holla, so kann es kommen: Erst dümple ich lektüretechnisch so durch das Jahr und am Ende sammelt sich dann noch mal einiges an. Komisch, hatte ich gar nicht so im Gefühl. Hier also der erste Teil der Leseliste Dezember 2021. Am Ende kommen noch zwei richtig tolle Bücher, das kann ich schon versprechen.
Hier aber erst einmal was aus meiner „ich möchte mal alles von Herrn
Lupoff lesen“-Kiste und die Abschlüsse von zwei persönlichen Lese-Challenges aus diesem Jahr: Ira
Lewin und L. Ron
Hubbard.
Warum ich das hier überhaupt mache? Na ja, als Weihnachts-Geschenkidee-Inspiration kommt es jetzt echt zu spät. Also: Keine Ahnung, ich mache es trotzdem.
An der Stelle - damit das Bildchen auch gerechtfertigt erscheint und weil ja heute der 24.12. ist:
Wünsche allen eine Frohe Weihnacht!Erst einmal der Abbruch des Monats:
Anthony Burgess: „Der Fürst der Phantome“Da hat mich wohl was gebissen: Nach „Dune“ sollte es gleich noch so ein großes Teil werden. Irgendwie wollte ich auch meine „Englische Phase“ noch weiterführen, vielleicht mit diesem Mammutwerk zum Abschluss bringen (Amis, Burgess).
Aber da habe ich mich überhoben. Die knapp 900 Taschenbuchseiten, mit nicht gerade großer Schrift zogen sich - bis ich dann gänzlich aufgab.
Warum? Aus meiner Sicht wegen Ereignislosigkeit. Der Stil, auch die Hauptfigur, der schwule Bohemien-Schriftsteller aus England, gefallen mir durchaus. Der Start war eigentlich auch gelungen: Der alte Schriftsteller erhält in den 70ern den Auftrag, etwas über den gerade verstobenen Papst zu schreiben. Der Papst ist ein Jugendfreund des Schriftstellers, der ist aber alles andere als ein gutes Schäfchen der katholischen Kirche. Das war einem schnell klar, als der Rman dann chronologisch in der Zeit des 1. Weltkrieges startet und der gerade erfolgreich werden Autor seine Homosexualität einem Priester beichtet, der das gar nicht tolerabel findet.
Der Roman soll dem feuilletonistischen Einvernehmen nach so ein Überblick über das 20. Jahrhundert bieten. Aber in den persönlichen Befindlichkeiten und eher belanglosen Begebenheiten, die ich in den 190 Seiten, die ich geschafft habe, erleben konnte, habe ich von diesem spannenden Jahrhundert eigentlich nicht viel mitbekommen. Na ja und so dolle sind mir die Figuren dann doch nicht ans Herz gewachsen, dass es mich durch den gesamten Ziegelstein leiten führen könnte.
Angela und Karlheinz Steinmüller: „Warmzeit“In der Werkausgabe, die jetzt bei Memoranda erscheint, ist das Band 1, der aber als vorletzter Band der Prosa-Werke im Frühjahr 2022 neu erscheinen wird. Ich habe das Buch als Manuskript jetzt in der Mangel, aus gegebenem Anlass (Vignette zeichnen). Die Shayol-Ausgabe habe ich gar nicht, die 2003 erschien. Hatte ich damals verpasst.
Keine Ahnung, wie mir der Band damals aufgefallen wäre. Jetzt aber fiel er mir dolle auf: Als quasi prophetisches Werk. Allein die Titelstory! Eine Vorwegnahme der Ereignisse und psychologisch-politisches Verwerfungen in Europa/Deutschland, die um 2015 mit der Flüchtlingskrise einsetzten. Das ist schone erstaunlich, wie das Autorenpaar hier Dinge vorausahnte.
Und dann die Belt-Geschichten. Es sind ja oftmals Stories, die bereits ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Sie nun hier noch einmal präsentiert zu bekommen, in einer Zeit, da „The Expanse“ Furore macht, ist ebenso erstaunlich. Die Stories, die im Belt spielen, sind denen aus der berühmten Roman- und TV-Filmserie ähnlich, denn sie greifen den Alltag der Belt-Bewohner, im Kontrast zu den Menschen der Planeten, anschaulich auf. Könnte man jetzt ja wie ein Ansetzen am Erfolg Anderer sehen, aber die Stories stammen ja teilweise aus den 70ern†¦
Insgesamt eine feine Lektüre, ich gebe aber keine Punkte, möchte aber den gerade im Entstehen befindlichen Band wärmstens empfehlen; es wird auch drei neue Stories geben, die wohl in der Shayol-Ausgabe nicht enthalten waren.
Ira Levin: „Die sanften Ungeheuer“Die Ira-Levin-Lesung zusammen mit meinem ASFC-Clubkollegen Volker Adam war ja schon (das Ergebnis ließe sich im NEUEN STERN 72 nachlesen). Aber ich scheine mit dem Autor noch nicht „durch“ zu sein. Volker hat mir nämlich sein Exemplar der „Sanften Ungeheuer“ ausgeliehen. Selbst zu kaufen, war ich zu geizig, ist aber auch eine recht kostspielige Angelegenheit gerade: Nach meinem Kenntnisstand bekommt man die TB-Einzelausgabe derzeit nicht unter 20 Euro. Ich las hier die aus dem Verlag Das Beste. Unterwegs in der Welt von morgen, wo noch ein kurzer Text von F. Pohl enthalten ist. Den kam man ja auch lesen - mach ich gleich†¦
Jetzt also Levins klassische Dystopie! Ja, der Roman hat - fast - das Zeug dazu, in den Reigen der klassischen Dystopien aufgenommen zu werden. Aber er wird, soweit mir bekannt, tunlichst ignoriert. Vielleicht liegt es einfach daran, dass der Roman Elemente enthält, die die klassischen Dystopien (kurz) zuvor bereits entwickelten und in die Diskussion warfen.
Levin gehört hier eindeutig ins Team Huxley, hat aber auch ein bisschen was von „Clockwork Orange“, zumindest was die Frage der psychologischen Triebkraft menschlicher Schöpfungskraft betrifft.
Es handelt sich um eine „schöne neue Welt“, in der †¦
- eine feste Ideologie („Marx, Christus, Wood und Wei“ - wobei zwei ja historisch verbirgt {mehr oder weniger}, und der eine der beiden anderen sogar noch in die Romanhandlung lebt und eingreift) herrscht,
- es medizinische „Behandlung“ und Drogenverabreichung zur Konditionierung gibt,
- natürlich auch totale Überwachung gibt - hier quasi durch eine KI (für die hätte aber Levin ruhig in den Reigen der großen Dystopisten aufgenommen werden können!),
- genetische Manipulation zur Erreichung eines ästhetischen und gesundheitstechnischen Gleichklangs aller Menschen angewandt wird
- und eine damit den Mitgliedern dieser utopisch-dystopischen Gesellschaft als wunschgemäß erscheinende Gesellschaftsordnung erschaffen wurde. Die Menschheit ist vereint und quasi eine große Familie.
Zudem, auch wie bei Huxley, gibt es Orte, an denen „Unheilbare“, also Unbelehrbare extrahiert, an- oder ausgesiedelt werden können. Sie können da einem vermeintlichen Wunsch nach Freiheit und Unangepasstheit nachgehen, landen allerdings in einer ziemlich harten, marktwirtschaftlich organisierten Welt, die zudem von Fremdenfeindlichkeit und katholischem Glauben geprägt ist.
Das Alter der idealen Menschen ist übrigens auf 62 Jahre beschränkt. Das soll der Überbevölkerung entgegenwirken. Das wäre dann ja noch so ein Element, das man vielleicht aus „Logan†™s Run“ kennt.
Wie auch immer, anfänglich hatte ich so meine Probleme, mich in diese seltsam befriedete und mir künstlich erscheinende Welt zurecht zu finden. Interessant war es im Rückblick aber schon, denn Levin lässt es durchaus ein wenig in der Schwebe, ob es sich hier um utopische oder dystopische Zustände handelt. Also auch ähnlich wie bei Huxley, oder - platter - wie in „Matrix“.
Die Handlung ist ziemlich spannend und weist überraschende Wendungen auf. Der Protagonist erscheint mitunter nicht gerade heldenhaft. Aber damit dürfte er sich, was seinen Ruf anbelangt, mit Alex aus „Clockwork Orange“ treffen.
Ach ja, der Burgess. Die Alternative zum ruhiggestellten Norm-Menschen ist der wilde, ungezügelte, aggressive, gewalttätige Unternehmergeist. Man bekommt halt keinen idealen Menschen, also auch keine ideale Gesellschaft. Das bleibt als Fazit durchaus auch bei Levin übrig. Der Held der Story, der mir mehrfach sehr opportunistisch erschien, aber das trügt wohl, entscheidet sich für das „richtige“ Leben. Leider hat Levin uns nicht erzählt, was daraus wurde.
8 / 10 Punkte
Auch in dem Band enthalten:
Frederik Pohl: „Donovans Traum“Die längere Erzählung schrieb er 1947. Damals konnte man noch von einer von Menschen besiedelten Venus schreiben. Auf der lebt es sich wohl ganz passabel, ist halt eine Gegend mit vielen Sümpfen.
So richtig viel hat der Autor in das Setting nicht investiert. Wie kriegen hier mal wieder so eine Art futuristischen Polit-Thriller geboten. Als Antwort auf den realen irdischen Welt-Konflikt kann man die Story aber auch nicht lesen. Insofern ist sie keine würdige Ergänzung für die Levin-Dystopie.
Auf der Venus gibt es zwei politische Mächte, die sich erbittert verfeindet gegenüber stehen. Die Donovans mussten sich in ein Sumpfversteck zurückziehen. Die herrschenden Hags können ihre Macht mittels Robots aufrecht erhalten. Der dritte Player meldet sich aber zu Wort: Die Erde. Dort ist man auf die Uran-Vorkommen der Venus scharf. Jetzt muss man einfach schauen, ob der Feind meines Feindes mein Freund sein kann.
In dem Rahmen entspannt sich ein mäßig spannendes Abenteuer, in dem natürlich die Guten siegen.
Wäre das jetzt hier ein eigenständiges Werk, das ich in meine Wertungsliste aufnehmen würde, wären das mal gerade 6 / 10 Punkte. Mach ich aber nicht.
„Der vierte Zeitsinn“Die besten SF-Stories aus The Magazine Of Fantasy And Science Fiction, 38. Folge, Heyne 1974
Weiter auf den Spuren von
Richard Lupoff. Diesmal führt mich die Reise ins Jahr 1974. In dem Bändchen befindet sich DIE Story, die im Grunde die Vorlage für den berühmten Film mit dem Murmeltier und Bill Murray bot. Die Story selbst ist 2-mal verfilmt worden. Enmal fürs Fernsehen, das andere Mal für das Kino. Der Film ging unter, vielleicht weil er im direkten Vergleich zu dem berühmten Film verlor. Aber er kst icht übel; habe ihn gern gesehen - und nun wollte ich halt auch die Story dazu lesen.
Aber der Reihe nach. Den Auftakt macht
Albert Teichner mit
„Der Vierte Zeitsinn“.
Nicht übel, wie ich fand. Zwei ältere Ärzte wollen mal aus ihrem Trott raus und gehen zum Pferderennen. Dort werden sie von einem anderen älteren Herrn angesprochen, sie sollen mal 50 Dollar auf ein Pferd setzten. Er garantiert einen großen Gewinn. Und? Ja, er behielt Recht.
Er hat immer Recht - als würde er die Zukunft kennen! Und? Ja, er kennt sie. Das Ganze hat natürlich einen Haken und zur Lösung desselben sollen die Ärzte ihm helfen.
Diese persönliche medizinische Zeit-und-Raum-sind-relativ-Story hat mir sehr gut gefallen!
Der Autor wird in der isfdb geführt, aber ohne Lebensdaten und mit nur wenig Bibliografie. Es scheint, als wäre diese Story die einzige, die ins Deutsche übertragen worden. Hmm, Schade eigentlich†¦
Die nächste Story ist dann wieder so eine, wo ich mich frage, was der Autor mir damit sagen wollte. Und ob es sich überhaupt um SF handelt. Aber: Die war trotzdem richtig schön. Ja, „schön“ ist der richtige Ausdruck. Und zwar, weil sie zu der Sorte gemütlicher Katastrophen gehört - wobei: ist hier wirklich etwas Katastrophales passiert?
Im tiefen Winter, in der Nachtredaktion einer kleinen Lokalzeitung, in einem US-Kaff, wo eigentlich gar nichts passiert und der dauerhafte Nacht-Redakteur wie immer seinen Almanach studiert und auswendig lernt. Da ruft jemand an und fragt was zu Hummern, also diesen Krebstieren.
Als dann im Schneesturm der Storm und das Telefon ausfallen, könnte man ja irgendwie meinen, jetzt passiert wirklich was Seltsames. Und? Also, komisch, die Story endet - ohne ein richtiges Ende! Damit hätte ich nun gar nicht gerechnet, war richtig überrascht - und ratlos.
Ach so, der Autor:
Raylyn Moore, die Story:
„Der Hummer-Trick“. Den Autor kenne ich auch nicht, und viel gibt†™s auf Deutsch von ihm nicht. Da sieht es mit dem folgenden Beitragslieferanten anders aus:
Ron Goulart. Das war mal einer der ersten nach der „Wende“, den ich las. Hab ihn aber aus den Augen verloren.
„Vorschuß“ fetzt! Es geht um einen ehemaligen NSA-Agenten in der nahen Zukunft. Die moderne Welt (90er Jahre, 20. Jh.) ist schon ziemlich weit vollautomatisiert. Überall Automaten, die einem das Leben erleichtern - und die Brieftasche auch. Geld, Kredite etc. spielen eine Riesenrolle und als Schuldner lebt man mitunter ungemütlich.
In diesem Spielfeld konstruiert der Autor mit wenigen Worten eine gar nicht mal unkomplexe politische Geheimagentenstory. Das Ganze ist spannend, ironisch und spielt mit dem damals (70er Jahre) noch herrschenden Fortschrittsglauben. Hat mir sehr gefallen.
Kit Reed - kurzer Name (richtig hieß sie Lilian Craig Reed), kurze Geschichte:
„Hundstage“. Hunde werden in dem auch ansonsten verwahrlosten Land zur Plage, für andere aber zum Selbstschutz gehalten. Das bietet genug Konfliktpotential, um am Ende sogar die Frage nach Tod und Leben zwischen Hund und Mensch zu stellen. Interessante, wenn auch ziemlich abwegige Idee.
G.C. Edmondson: „Wer glaubt schon einem Indianer“. Diese Story mit dem leicht politisch-unkorrekt anmutenden Titel (heute, wenn man es genau nimmt) habe ich nicht verstanden. Soviel habe ich schon verstanden, dass in ihr die amerikan. Ureinwohner nicht verunglimpft werden, auch keine Klischees breitgetreten, oder so. Aber worum geht es hier wirklich? Um das Verhältnis von mexikanischen Einwanderern in den USA zum US-Saat? Um Tomatenanbau, oder den Anbau von Haschisch in Mexiko? Oder um Außerirdische, die sich in Amerika ähnlich freimütig bedienen, wie weiland die europäischen Einwanderer?
Auch
Philip José Farmer konnte mich mit
„Eva“ nicht überzeugen. Es handelt sich um eine bizarre Agentengeschichte, in die der Autor ein bisschen von seinem geliebten Alien-Sex-Zeug einmischt. Aber nur wenig und auch nicht wirklich erotisch. Ein Privatschnüffler wird für ein staatliches Projekt engagiert. Dabei bekommt er seltsame Probleme, wie z.B. eine Überempfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht, oder dauernde Anrufe, vor allem dann, wenn er sich mit einer Dame trifft.
Das mit der Liebe, stellt sich heraus, ist dann sogar der Schlüssel für die Dinge, die da passieren. Eine Liebe zwischen einem Satelliten (Eva) und dem Agenten Lane. Dabei hätte er sich fast mehr als nur die Finger verbrannt, denn dieser kleine künstliche Erdtrabant strahlt mächtig ihren Geliebten an.
Na ja, da der Autor hier in Erklärungsnot geriet, konnte ich dann über solche Sätze fast nicht mal mehr schmunzeln:
„Ich fragte mich außerdem, ob eine Wissenschaftlerin unbewusst weibliche Stromkreise konstruieren könnte.“ (S.106) - Echt jetzt?
Jetzt aber zu dem Text, für den ich das Bändchen erwarb:
Richard A. Lupoff: „12:01“.Der war dann auch wieder gut! Was mich erwartet, ahnte ich schon, war aber schon sehr gespannt, was der Autor in dieser kurzen Erzählung von dem erzählt, was man ja aus dem Murmeltier-Film mit Murray und auch aus der Verfilmung der Erzählung, die zur gleichen Zeit wie das der Film mit dem Murmeltier im Kino lief (und wenig beachtet wurde). Es geht schlicht um eine Zeitschleife, in der ein Zeitraum immer wieder wiederholt wird. In den Filmen hat man sich auf einen Tag geeinigt. Da kann wenigstens was passieren, was sich des filmischen Erzählens lohnt.
Die Story beschreibt einen Zeit-Raum von 1 Stunde. Darunter leidet der Protagonist sehr - mehr als Bill Murray oder Jonathan Silverman als Barry Thomas in dem Film „12:01“, die jeweils einen Tag, wenn auch immer denselben, zur Verfügung haben.
In der Originalstory kann der Mann nichts machen, ist hoffnungslos, obwohl er es versucht. Selbst der Tod erlöst ihn nicht. Die Story ist so vom Grundthema viel, viel schwärzer und negativer als die Filme, die ja ein gutes Ende nehmen.
Großartig erzählt, klarer Plot (wohltuend nach den Stories davor), klare Aussage. Der Mann hat†™s drauf!
Wertung des Buches insgesamt? Schwierig, aber nach ersten tollen Eindrücken wurde der Band nach hinten zu schlechter, um mich dann aber mit Lupoff zufrieden zu entlassen.
Also 7 / 10 Punkte
Aber wer, wie ich, es auf bestimmte Autoren absieht, soll sich von so einer Wertung nicht abschrecken lassen!
L. Ron Hubbard: „Bote des Grauens“Vampir Horror-Roman 26, 1973 (orig. v. 1940)
Das ist jetzt der letzte Hubbard, den ich zu liegen hatte. Damit ist das Kapitel dann wohl abgeschlossen.
Sicherlich ist der Roman wieder mächtig gekürzt, aber auch hier könnte ich mir vorstellen, dass mehr Text nicht unbedingt mehr Inhalt bringt.
II. Weltkrieg: Ein Militärflieger wird in seiner Maschine im Gefecht getroffen und verwundet. Er kann nicht mehr fliegen, was sein Lebensinhalt war. In einem Traum begegnet er einem Monster, dem personalisierten Unheil. Der bietet ihm einen Deal an, den er aber ausschlägt. Nun, das war irgendwie keine gute Idee, denn ab sofort hat er zwar Glück im Leben, aber alle Leute, die mit ihm zu tun haben, erleiden Unfälle etc. und sterben.
Das ist nun schwer anderen erklärbar, aber unser Protagonist muss davon ausgehen, dass es so ist. Interessanterweise kommt ein Versicherungsagent auf den gleichen Gedanken - der Mann verströmt Unheil und ist damit Gift für die Versicherungen. Die Lösung des Problems ist am Ende dann nicht wirklich glücklich zu nennen.
Eine hübsche Mystery-Story, mit einem übernatürlichen Element, das aber in der ansonsten realistischen und romantischen Erzählung (er findet seine große Liebe, die aber nicht funktionieren kann, aus gegebenem Anlass) nicht dominiert. Flott erzählt, das Ganze; hat mir durchaus gefallen.
8 / 10 Punkte
Thea Dorn: „Die Unglückseligen“Hörbuch, gelesen von
Bibiana BeglauDas wollte ich lange schon mal lesen: Diesen Roman einer von mir sehr geschätzten - Denkerin (?), Philosophin (?) - wie kann ich sie nennen? - der auch noch thematisch sowas wie SF ist.
So richtig ran kam ich an den Stoff dann aber nicht und hätte ich das Buch selbst gelesen, wäre ich wohl zwischendurch ausgestiegen. Die Vorleserin, Bibiana Beglau, macht ihren Job aber so gut, dass ich am Ball blieb.
Die Autorin spürt dem Geheimnis der Unsterblichkeit nach: Dem großen Menschheitstraum und nach Harari eine der nächsten Baustellen der Menschheit, die ja alle anderen Probleme - so Harari - wie Hunger, Kriege etc. bewältigt hat.
Ja, ich lass das mal so stehen†¦ (Würde ich das so schreiben, wie ich es hier geschrieben habe, würde ich es ironisch meinen)
Da gibt es also die Biologin, die meint, Tod sei auch nur eine Krankheit und dagegen müsse es ja ein Mittel geben. Und dann gibt es den Herrn Johann Wilhelm Ritter, der tatsächlich seit 200 Jahren nicht tot zu kriegen ist. Den Menschen gab es wirklich, hat sogar einen Wikipedia-Eintrag der übrigens im Roman genutzt wird.
Es kommt zu allerlei Verwicklungen und einer Romanze und endet im Wahnsinn.
Im Grunde „passiert“ nicht viel - wenn man als SF-Genre-Leser viel Plot und Action gewohnt ist. Die Autorin spielt lieber mit Ideen und vor allem mit Sprache. Genau das ist der Punkt, wo ich ihr nicht folgen kann: Der Roman befleißigt sich zum Großteil der Sprache des 18. Jahrhunderts, bzw. wirkt die Sprache halt altertümlich. Aber er spielt im 21. Jahrhundert. Erfrischend wird die Sprache dann auch wieder mit einem kräftigen „Fuck!“ in die Neuzeit geholt, aber es macht der Autorin sichtlich großen Spaß, so zu formulieren, wie es ein Zeitgenosse Goethes getan haben könnte.
Das ist nicht die Literatur, die ich gern lese, ich Kulturbanause. Aber vorgelesen bekam ich sie gern! Und Bibiana Beglau macht das richtig gut, mit Verve und Elan. Ich habe daher durchgehalten, kann aber persönlich für meinen Leseeindruck nur 6 / 10 Punkte geben.



 Benutzerdefiniertes Design erstellen
Benutzerdefiniertes Design erstellen