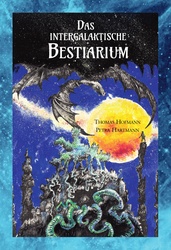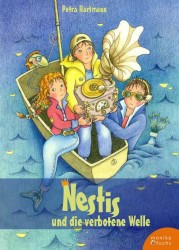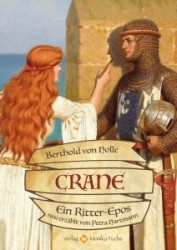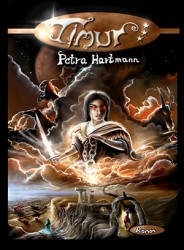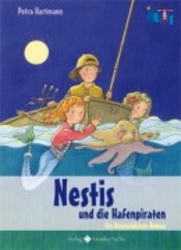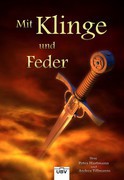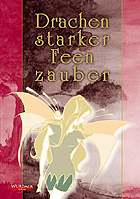Jahresrückblick I: Januar bis März 2020
Jahresrückblick
Zunächst einmal: Ich bin verschont worden und ausgesprochen dankbar dafür. Das Virus hat mich nicht erwischt, ich bin nicht erkrankt, ich habe im Familien- und Freundeskreis keine Krankheits- oder gar Todesfälle erlebt, und ich hatte auch beruflich keine Einschränkungen. Seit anderthalb Jahren bin ich nun bei der Goslarschen Zeitung unter Vertrag. Ich kann wieder fliegen, ich kann wieder zaubern, ich habe meine Unsterblichkeit zurück erhalten. Ein bisschen beschwipst bin ich vielleicht immer noch, aber daran stirbt man nicht. Ja, auch mir sind in diesem Jahr fast alle Lesungen und Buchpräsentationen weggebrochen, das war schade, aber ich war nicht finanziell darauf angewiesen. Ja, ich vermisse die Buchmessen und Cons und die Live-Treffen mit euch allen. Aber wenn das dazu beiträgt, uns alle gesund zu halten, ist es ein kleiner Preis.
Mein neues Buch "Falkenblut" ist erschienen, dann gab es noch zwei Anthologien mit Beiträgen von mir und haufenweise Zeitungsartikel, das ist eine gute Quote für dieses Jahr. Den Rest holen wir nach, wenn Corona weg ist, okay?
Mein Lektüre-Jahr war vielseitig. Hier folgt der Blick auf das erste Quartal. Ich habe mich natürlich wieder mit phantastischer Literatur befasst, dazu gab es etwas Indianisches, Flugpioniere haben mich beschäftigt, Kinderbuch-Klassiker und erneut viel Aufklärung und Haskala. Ein bisschen Goslar-Literatur war auch dabei und etwas Helgoländisches. Schaut einfach mal rein, vielleicht ist etwas für euch dabei. Viel Spaß beim Lesen!
Hinweis:
Etwaige blau markierte Texte sind herausragende Spitzenbücher, rot steht für absoluten Mist, ein (e) hinter dem Titel bedeutet, dass ich den betreffenden Text in der eBook-Version gelesen habe, und hinter den Links verbergen sich ausführlichere Besprechungen innerhalb dieses Blogs.
Januar
Alfred Hildebrandt: Die Brüder Wright
Nachdruck eines Buchs aus dem Jahr 1909, geschrieben von einem Journalisten, der sich mit der geheimnisvollen Flugmaschine der Brüder Wright befasst und Informationen einholt, unter anderem auch bei dem Vater der beiden. Sehr interessantes historisches Dokument. Mit Original-Briefwechsel im Anhang und mit einer Beschreibung der Flugmaschine. Sehr gut lesbar. Für mich auch wertvolles Material, das ich für meinen historischen Roman brauche.
Ulrike Stegemann: Alonsos Reise und andere Katzengeschichten
Liebenswürdiges Buch mit fünf Kurzgeschichten über die flauschigen Kleinraubtiere mit dem eigenwilligen Kopf und dem geheimnisvollen Wesen. Die Titelgeschichte erzählt von einem Hamburger Hafenkater, der sich auf ein Kreuzfahrtschiff schleicht und sich auf große Fahrt begibt. Eine andere spielt in Paris, wo ein Kater eine besondere Liebe für Schmuckstücke offenbart. Wir erleben die Verwandlung einer Katze in einen Menschen, außerdem gibt es in dem Buch eine sehr interessante Variation des Märchens vom gestiefelten Kater und die Geschichte einer Katze, die als Tänzerin ihr Publikum bezaubert. Ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Lesevergnügen, einfach zum Schnurren.
Otmar Hesse: Goslar und die salischen Kaiser
Berufliche Lektüre zur Geschichte meiner neuen journalistischen Heimat. Eine kurze, übersichtliche Darstellung der salischen Kaiser Konrad II., Heinrich III., Heinrich IV. und Heinrich V. und ihrer besonderen Beziehung zu Goslar. Die Stadt war für die damaligen Kaiser, die im Mittelalter ja ihr Reich zu Pferde durchreisten, von Pfalz zu Pfalz zogen und überall vor Ort regelten, was geregelt werden musste, einer der festen Bezugspunkte, und vor allem für Heinrich III. so etwas wie eine Heimatstadt oder Lieblingsaufenthalt. Er hing so sehr an Goslar, dass er verfügte, dass nach seinem Tod sein Herz dort begraben werden sollte. Ein Mythos, von dem die Stadt heute noch zehrt. Und die eindrucksvolle Kaiserpfalz, in der die salischen Kaiser während ihrer Goslar-Aufenthalte gewohnt haben, ist schon ein ganz besonderes Bauwerk. Mein besonderer Liebling war aber immer Heinrich IV., schon im Geschichtsunterricht hatte mich die Sache mit dem Investiturstreit wahnsinnig fasziniert. Die Schlagzeilen "Papst bannt Kaiser" und "Kaiser setzt Papst ab" in meinem Geschichtsbuch habe ich nie vergessen. Dass von Kaiser Heinrich am Ende nur noch der sprichwörtliche Gang nach Canossa im Gedächtnis der Bevölkerung geblieben sein soll, finde ich schade. Immerhin: Canossa war nur der Halbzeitstand, Heinrichs erstes Ungarnspiel sozusagen. Kluge Leute sollten also keine Probleme damit haben, mal nach Canossa zu gehen.
Das Buch ist kurz und knapp, sehr übersichtlich, reich bebildert und mit einem Preis von nur 5 Euro außerordentlich wohlfeil. Eine gute Einstiegslektüre vor allem für den Goslar-Neuling.
Die Welten von Thorgal: Thorgals Jugend VII - Blauzahn
Sibylle Luig: Magie hoch 2 - Band III: Diebe in Berlin
Hörbuch:
Gerald Hüther, Christoph Quarch: Rettet das Spiel!
Interessantes und hörenswertes Plädoyer für das Spiel. Die Autoren gehen aus von philosophischen, hinrphysiologischen und sozialen Theorien über das Spiel und machen deutlich, dass es nur die Fähigkeit zu spielen ist, die die menschliche Entwicklung voranbrachte. Manchmal sehen die Verfasser allerdings zu viel Spiel in der Welt: Einen Zufall wie etwa das Crossing over von Chromosomen oder bestimmte Vorgänge im Universum als "Spiel" zu bezeichnen, geht mir persönlich etwas zu weit. Aber generell kann ich der Argumentation schon folgen, wenn die Verfasser darauf hinweisen, dass große Erfindungen und Entdeckungen aus dem freien Spiel heraus geboren werden. Marketing und große technische Abteilungen können immer nur "lineare Entwicklungen" voran treiben. Das heißt: Wenn sie wissen, wie es geht, können sie die Ideen und Erfindungen dann mit immer mehr Geld und Material immer größer und immer aufwändiger weiter entwickeln, aber der zündende Gedanke, der wirklich etwas Neues hervorbringt, wird immer vom einzelnen, unaustauschbaren Individuum in einer entspannten, absichtslosen Atmosphäre, im Traum, immer abseits mechanischer Vervielfältigung und Vergrößerung gefasst. Nennen wir es: Spiel. Auch dies eine klare Argumentation gegen Bulimie-Lernen und das Einpauken von Stoff, um am Ende kleine, brave, funktionierende Zahnrädchen zu gewinnen, die reibungslos und ohne Aufwand in die industriellen Arbeitsplätze eingepasst werden können. Wir brauchen Menschen. Und der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt ...
Februar
Miriam Rademacher: Talisman und das tote Dorf
Dallas Chief Eagle: Wintercount
Ein historischer Indianer-Roman, verfasst von einem Lakota-Indianer. Erzählt wird die Geschichte eines frisch vermählten Paars: Der junge Krieger Keyaschante (Schildkrötenherz) und Tscheyasa-win, die "Frau, die immer weint", sind ein glückliches Liebespaar und feiern den Tag ihrer Hochzeit. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Das Dorf wird von Banditen überfallen, die eigentlich nur Pferde stehlen wollen, aber dann das Paar mitnehmen - als Wegweiser und Geiseln. Wenig später kommt es zu einem Kampf, bei dem Schildkrötenherz schwer verletzt wird. Die Männer halten ihn für tot und lassen ihn liegen, während sie seine Frau mitnehmen in ein Fort der Weißen. Denn die hellhäutige Tscheyasa-win ist eigentlich eine Weiße, sie wurde lediglich als kleines Kind von den Lakota nach einem Überfall eines anderen Indianerstamms gefunden und aufgenommen. Während sie ihren Mann für tot hält und von den Weißen nach Osten gebracht wird, wo sie wieder in ein "zivilisiertes" Leben integriert werden soll, erholt sich Keyaschante langsam von seinen Verletzungen. Er kehrt zu seinem Volk zurück, um Kraft zu sammeln, dann will er losziehen und sich auf die Suche nach seiner entführten Frau machen. So weit, so gut. Es kommt dann allerdings immer wieder etwas dazwischen, die bekannten historischen Ereignisse nehmen ihren Lauf, Keyaschante wird einer der Häuptlinge seines Volkes, führt Krieg an der Seite Sitting Bulls und Crazy Horses gegen die Eindringlinge, sieht seine Verwandten und Freunde sterben. Erst spät, als Tscheyasa-win mehr zufällig erfährt, dass ihr Mann noch lebt, und sich auf den Weg in den Westen macht, finden die beiden wieder zusammen.
Das Buch ist als Buch eines Angehörigen des Lakota-Volkes natürlich ein wertvolles Dokument und eine kleine Besonderheit. Literarisch lässt es allerdings einiges zu wünschen übrig. So wird nach der Trennung zwar ein paarmal darüber gesprochen, dass Keyaschante sich auf die Suche nach seiner Frau machen will, aber es unterbleibt, und am Ende scheint es auch gar nicht so wichtig, diese Frau wieder zu finden.
Ähnlich wenig Fleisch auf den Rippen hat der Teil der Geschichte, der von Tscheyasa-wins Aufenthalt bei den Weißen erzählt. Man merkt keine Eingewöhnungs- und Umgewöhnungs-Probleme, obwohl sie doch als kleines Kind zu den Lakota kam und vollständig indianisch sozialisiert wurde. Von Erinnerungen an ihre "weiße" Vergangenheit findet sich nichts, und trotzdem ist sie sofort voll integriert, wird ohne weiteres in eine weiße Familie aufgenommen, erlebt nicht die Spur irgendwelcher Garstigkeiten und Gehässigkeiten, eckt nirgends an, hat nirgends das Gefühl, dass es in der Lakota-Gesellschaft aber menschlicher, ehrlicher, gerechter o.ä. zuginge, und hat sogar die Gelegenheit, eine "gute Partie" zu machen, als ein angesehener, leidlich wohlhabender und auch nicht unbedingt unsympathischer junger Mann um sie wirbt. Ja, wenn das so einfach wäre, von weiß zu rot und dann wieder zurück zu wechseln, warum haben sich die Völker dort drüben eigentlich bekriegt?
Die titelgebende "Wintererzählung" erweist sich gleichfalls als ein blindes Motiv. Zwar wird Schildkrötenherz im Buch von seiner Großmutter seine eigene, persönliche Wintererzählung, eine auf Leder aufgemalte Geschichte seines Lebens, übergeben, aber abgesehen von einigen Stellen, an denen er stolz darauf ist, einen persönlichen Wintercount zu haben, wird auf die Sache nie näher eingegangen. Man erfährt nie, was drin steht in der Geschichte und was sein Großvater eigentlich aufgezeichnet hat.
Auch die Wiederbegegnung der beiden Liebenden geht, wie bereits gesagt, auf einen reinen Zufall zurück. Es ist keine Leistung Keyaschantes, seine Frau wieder zu finden. Insofern bleibt alles zufällig, beliebig, nichts hängt zusammen, keine Handlung geht aus der vorherigen hervor.
Plutarch: Die Kunst zu leben (Insel)
- Über die Seelenruhe
- Über die Schwatzhaftigkeit
- Gesundheitsregeln
- Ratschläge für die Ehe
- Trostbrief an die Gattin
- Über Kindererziehung
- Das Gastmahl der Sieben Weisen
Von Plutarch hatte ich bisher nur die Parallelbiographien gelesen. Dieses Insel-Taschenbuch mit ausgewählten Schriften fiel mir mehr oder weniger zufällig in die Hände, ein Fundstück aus dem Prämienshop bei ebook.de. Es ist eine Auswahl, getroffen und übersetzt von Marion Giebel, die ich sehr schätze. Enthalten sind außer den oben genannten Texten auch ein Vorwort und zu jedem Text eine kurze Einführung, ferner gibt es im Anschluss ein paar hilfreiche Anmerkungen. Insgesamt ein sehr lesbares Buch in der geschmeidigen und eleganten Handschrift Plutarchs mit sehr vernünftigen, eben stoischen Ansichten. Ein guter Begleiter für unterwegs. Wenn auch der gefeierte Trostbrief an die Gattin ein wenig oberlehrerhaft daherkommt, und nicht tröstend.
Reinhard K. Sprenger: Total Digital
Sprenger hat wie immer einen guten Schreibstil und kluge Gedanken aufzubieten. Ich schätze seine Bücher sehr, auch darum, weil es mir danach immer ziemlich gut geht ... Als kleine Warnung möchte ich hier allerdings zweierlei vorwegschicken: Zum einen geht es hier nicht darum, wie man Digitalisierung im Unternehmen technisch hinbekommt und was alles möglich ist. Wer also hier nach Informationen sucht, welche Software man einkaufen sollte, um ein Unternehmen umstrukturieren, ist hier fehl am Platz. Das zweite ist, dass das Buch in extrem kurze Kapitel eingeteilt ist, meist nicht mehr als eine Seite. Das hat den Vorteil, dass man es häppchenweise lesen kann, in der Werbepause beim Fernsehen, in der U-Bahn, auf dem Klo oder wo auch immer, aber es hat keinen "Fluss" und ist keine groß angelegte Analyse mit anschließendem Programm, sondern es ist angelegt als Rezeptsammlung, die auch nicht in einer vorbestimmten Reihenfolge gelesen werden muss. Das wird auch geradezu als Leseempfehlung vorangestellt.
Inhaltlich bietet Sprenger einen sehr erfrischenden, humanen Ansatz zum Umgang mit der Digitalisierung. Eben, indem er den "Faktor Mensch" wieder in den Mittelpunkt stellt und klarmacht, dass gerade der Mensch den Unterschied macht und nicht irgendwelche Algorhythmen und Technologien.
Er setzt drei Schwerpunkte: Zum einen rät er, das Unternehmen wieder "vom Kunden aus" zu denken, also nicht immer wieder neue Möglichkeiten auf den Markt zu werfen und dann zu versuchen, das Zeug irgendwie an den Mann zu bringen, sondern ganz konkret bei jeder neuen Entscheidung zu fragen: Was will der Kunde? Welche Probleme will er gelöst haben? Was können wir ihm anbieten, um genau das zu tun?
Der zweite Schwerpunkt ist der Bereich der Kooperation und zwar sowohl der besseren Zusammenarbeit von Mitarbeitern im Unternehmen als auch gemeinsamer Initiativen mehrerer Unternehmen, die an bestimmten Projekten zusammenwirken.
Drittens legt Sprenger den Fokus auf das, was den Menschen schon seit jeher über die Maschine erhob: die Kreativität.
Ein interessanter Ansatz. Und einer, der Mut macht. Es geht gar nicht darum, den Wettbewerb mit der Maschine zu gewinnen. Sondern darum, uns genau auf das zu konzentrieren, was uns als Menschen ausmacht. Und das ist nicht, immer größere Datenmengen sammeln und zusammenzustöpseln ...
Eleanor H. Potter: Pollyanna
Kinderbuch-Klassiker, den ich schon lange mal lesen wollte. Jetzt kam er mir in der Buchhandlung im Goslarer Bahnhof in einer 5-Euro-Hardcover-Ausgabe in die Finger, und das muss man doch mitnehmen. Pollyanna mit ihrem unerschütterlichen Optimismus und ihrem "Freude-Spiel" ist im anglophonen Sprachraum geradezu sprichwörtlich geworden. Der Ausspruch "I am such a Pollyanna!" bedeutet so viel wie: Ich bin so ein fröhlicher optimistischer Mensch, meine naive Lebensfreude lässt sich einfach nicht auslöschen ...
Die Geschichte ist eine typische Waisenkind-kommt-zu-griesgrämiger-Pflegeperson-und-verwandelt-sie-durch-seine-naive-liebevolle-Art-in-einen-Riesenphilanthropen-Story. Denkt an Anne auf Green Gables oder den kleinen Lord oder sowas. Pollyanna hat ihre beiden Eltern verloren. Aber sie hat von ihrem Vater ein unfehlbares Gegengift gegen alle Verzweiflung mit auf den Lebensweg bekommen, eben das Freude-Spiel. Wann immer ihr irgend etwas Trauriges und Niederschmetterndes begegnet, dann will es die Spielregel, dass Pollyanna dieses Erlebnis so lange dreht und wendet, bis sie am Ende doch irgend etwas Gutes daran gefunden hat, über das sie sich freuen kann. Zu einer wahren Meisterschaft hat sie es einst gebracht, als sie zum Geburtstag statt der heißersehnten Puppe von einer Gruppe von Wohltätigkeitsdamen nur ein paar Krücken erhielt. Absolut aussichtslos, an diesen hässlichen Dingern noch etwas Erfreuliches zu finden? Doch. Pollyanna braucht zwar einige Zeit, bis sie die Lösung entdeckt, aber dann geht ihr ein Licht auf: Sie freut sich riesig darüber, dass sie diese Krücken nicht benötigt.
Auf diese Art gefeit gegen alle Verzweiflung kommt Pollyanna ins Haus ihrer Tante, einer griesgrämigen alten Dame, die es Pollyannas Mutter nie verziehen hat, dass diese eine "gute Partie" ausgeschlagen und stattdessen einen armen Geistlichen geheiratet hat. Aber Pollyanna lässt sich nicht unterkriegen, freut sich über alle Garstigkeiten und Gedankenlosigkeiten, mit denen die Tante ihr den Aufenthalt eigentlich zur Qual machen müsste, und nach und nach lehrt sie alle frustrierten Bewohner der Kleinstadt ihr Freude-Spiel. Bis eines Tages etwas passiert, über das sich selbst Pollyanna nicht mehr freuen kann ...
Das Freude-Spiel wird oft in der Ratgeber-Literatur zitiert, es ist so eine Art umgekehrte "Anleitung zum Unglücklichsein". Insofern war es interessant, hier einmal die Quelle kennen zu lernen. Literaturwissenschaftlich betrachtet ist das Buch allerdings nicht die ganz große Literatur, es kann nicht mit Waisenkind-Klassikern wie "Anne auf Green Gables", "Oliver Twist", "David Copperfield" oder "Eine kleine Prinzessin" mithalten, dazu ist Pollyanna zu eindimensional und nur auf dieses eine Spiel fixiert. Aber, wie gesagt, es war interessant.
März
Alessandra Reß: Die Sommerlande
Hartmut Bomhoff: Israel Jacobson - Wegbereiter jüdischer Emanzipation
Handliche, sehr kompakte Überblicksdarstellung aus der Reihe "Jüdische Miniaturen". Israel Jacobsohn war so eine Art Martin Luther des Judentums, also derjenige, der das Reformjudentum erfunden hat. Interessanterweise nahm das Ganze in Seesen seinen Anfang, also fast direkt bei mir vor der Haustür, wo Jacobsohn im Jahr 1810 die erste Reformsynagoge gründete. 1815 führte er in Berlin liberale Gottesdienste ein. Eine sehr spannende Geschichte. Ich mag die Reihe ohnehin, sie bietet jeweils einen guten Einstieg in die entsprechenden Persönlichkeiten.
Reimer Boy Eilers: Das Helgoland, der Höllensturz: Oder Wie ein Esquimeaux das Glück auf der Roten Klippe findet, obwohl die Dreizehenmöwen hier mit Rosinen gegessen werden (e)
Saul Ascher:Ausgewählte Werke:
- Soll der Jude Soldat werden?
- Leviathan oder Ueber Religion in Rücksicht des Judenthums
- Ideen zur natürlichen Geschichte der politischen Revolutionen
- Ansicht vom künftigen Schicksal des Christenthums
Sehr gediegene, ausgesprochen werthaltige Hardcover-Ausgabe mit einer allgemeinen Einleitung zu Saul Aschers Leben und Werk und vier Einzel-Einführungen zu den aufgenommenen Schriften, sie enthält auch eine Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur und einen Index. Etwas vermisst habe ich Aschers "Germanomanie". Die hätte in einen Band innerhalb einer Reihe mit dem Titel "Schriften zu Staat, Nation, Gesellschaft" unbedingt mit dazu gehört. Aber ich vermute mal, dass sie weggelassen wurde, da es noch eine weitere Ascher-Sammlung auf dem Markt gab, die die Germanomanie enthielt (dazu mehr im nächsten Quartal).
Ascher widmet sich in den Schriften politisch-gesellschaftlichen Themen und liefert geschichtsphilosophische Betrachtungen mit ungewöhnlicher Perspektive und ungewöhnlichen Ergebnissen. Sehr interessant fand ich seine Betrachtungen zur Frage "Soll der Jude Soldat werden?" Dies war zu der Zeit ein heiß diskutiertes Thema. Seit Christian von Dohms Schrift "Über die bürgerliche Verbesserung der Juden" (1781) war immer wieder darüber diskutiert worden, dass Juden, wenn sie denn die Staatsbürgerschaft. z.B. die preußische, bekommen, nicht nur die Rechte, sondern eben auch alle Pflichten eines Staatsbürgers haben, und gerade in Preußen war damit dann nicht nur auch, sondern vor allem die Wehrpflicht gemeint. Die Argumente dafür, dass Juden womöglich als Soldaten nicht geeignet waren, waren vor allem: 1) das Sabbatgebot, verbunden mit der Frage, ob Juden am Samstag überhaupt kämpfen und für den Krieg üben durften, 2) die Speisevorschriften, was die Frage aufwarf, ob jüdische Soldaten im Krieg überhaupt ernährt werden können, 3) damit verbunden die Feststellung, dass Juden aufgrund ihrer Ernährung - ob koscher oder aufgrund armutsbedingter Mangelernährung - doch meist sehr dünne und schwächliche Personen seien und dem Einsatz im Krieg physisch gar nicht gewachsen, und 4) die Loyalitätsfrage: Wären Juden bereit, sich für ihre jeweiligen Heimatländer totschießen zu lassen, oder fühlen sie sich diesen Staaten weniger verbunden, da sie dort ja bislang jahrhundertelang Fremde mit eingeschränkten Rechten waren? Viele Juden haben, wie die Teilnahme am Ersten Weltkrieg zeigte, mit Begeisterung für ihr Vaterland in die Schlacht ziehen wollen ...
Ascher bezieht sehr klar eine Gegenposition. Er geht aus von einer zeitgenössischen Schrift, die unter der Überschrift "Soll der Jude Soldat werden?" angetreten ist, aber dann nur die Frage beantwortet: "Kann der Jude Soldat werden?" Ascher rügt diesen Etikettenschwindel. Und dann geht er selbst diesem "soll" nach, das bislang in der Diskussion vernachlässigt wurde. Sein hartes, provokantes Urteil lautet: "Nein."
Aschers Argumentation: Wer Soldat werden soll, um sein Vaterland zu verteidigen, der ist dazu verpflichtet, wenn er denn ein Vaterland hat und von diesem von Kindesbeinen an Wohltaten empfangen hat. Ein christlicher Bewohner eines bestimmten Landes ist von Geburt an in den Genuss der staatlichen Fürsorge gekommen, ist aufgewachsen in Sicherheit, hat Schulunterricht erhalten, die Polizei schützte sein Eigentum und seine Sicherheit usw. Damit ist der christliche Staatsbürger auch verpflichtet, sich für diesen Staat einzusetzen. Ein Jude, der jetzt plötzlich die Staatsbürgerschaft erhält, aber vorher sein Leben lang unterdrückt wurde, hat diesem Staat gegenüber noch keine Verpflichtungen, hier ist der Staat erst noch in der Bringschuld. Erst die Angehörigen der nächsten Generation, die als vollwertige Staatsbürger aufgewachsen sind und alle Segnungen des Bürgerrechts frei genießen konnten, seien dann auch in der Pflicht, Soldat zu werden. Ascher fehlte es nicht an Selbstbewusstsein und an Mut, auch mal gegen den Mainstream zu argumentieren.
Ebenso selbstbewusst tritt er im "Leviathan" gleichzeitig mit Moses Mendelssohn und Thomas Hobbes in die Schranken. Dabei sind vor allem deutliche Differenzen zu Mendelssohns "Jerusalem" festzustellen. Beide treten zwar für eine "bürgerliche Verbesserung der Juden" ein. Doch während Mendelssohn auf jeden Fall an der jüdischen Tradition festhalten will und eher auf Bürgerrechte als auf religiöse Formen und Zeremonialgesetze verzichten will, tritt Ascher dafür ein, das Judentum als ein Glaubenssystem zu denken, das als solches auch reformierbar und modernisierbar ist. Hierdurch erklärt sich auch der Titel: Bei Hobbes war der Leviathan, benannt nach dem gewaltigen biblischen Ungeheuer, noch der absolute Staat, der die Bürger (zu ihrem eigenen Schutz) knechtet und in vollkommener Unfreiheit hält. Für Ascher bezeichnet das Wort den zum Moloch angewachsenen jüdischen "Staat im Staate", der die Emanzipation der Juden verhindert.
In seiner Revolutionsgeschichte fasst er Geschichte geradezu als eine Abfolge von Revolutionen auf, die jeweils einen Fortschritt beziehungsweise eine Veränderung zum Besseren hin mit sich bringen. Ascher zufolge liegen in der Menschheitsentwicklung zwei Bestrebungen miteinander im Widerstreit, nämlich Sinnlichkeit und Vernunft. Leuten, die sich gegen Revolutionen aussprechen, wirft er vor, dass sie Ursache und Wirkung verwechseln: Revolutionen entstehen, wenn ein Missstand vorliegt, und ihr Ziel ist es, diesen Missstand zu beseitigen.
Dass sich Ascher als Jude in einem Aufsatz mit dem "künftigen Schicksal des Christentums" auseinandersetzte, wäre für einen jüdischen Autor der vorherigen Generation wohl undenkbar gewesen. Auch bei dem Spätaufklärer Ascher werden es noch sehr viele Leute ziemlich keck gefunden oder für einen Anfall von Hybris erklärt haben. Ascher ficht das nicht an. Er geht davon aus, dass die "Offenbarungsreligionen" inzwischen mehr oder weniger abgewirtschaftet haben. Offenbarung ist laut Ascher nicht aus der Vernunft zu begründen, lässt sich nicht denkend entwickeln, Offenbarungsreligionen seien dem Volk immer von außen aufgedrückt worden, hätten "nie einen unmittelbaren Zusammenhang mit den Völkern selbst gehabt", schreibt er. Sie seien zu ihrer Zeit möglicherweise notwendig gewesen. Ascher geht aber davon aus, dass mit zunehmender Entwicklung der Menschheit die geoffenbarte Religion nach und nach einer Weltreligion das Feld räumen dürfte. Einer Religion, die sich, gut aufklärerisch gedacht, mit dem menschlichen Verstand weiterentwickeln wird. Besonders im Protestantismus sieht er eine fortschreitende Entwicklung. Am Schluss könnte für eine Art Religion der Freiheit und Vernunft stehen, in der die Menschen im Bewusstsein ihrer Selbstständigkeit leben.
Fabienne Siegmund: Das Nebelmädchen von Mirrors End
© Petra Hartmann
Weiterer Jahresrückblick:
Teil II: April bis Juni 2020
Teil III: Juli bis September 2020
Teil IV: Oktober und November 2020
Teil V: Dezember 2020


 Benutzerdefiniertes Design erstellen
Benutzerdefiniertes Design erstellen