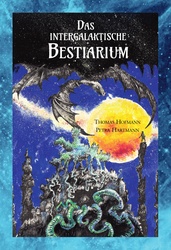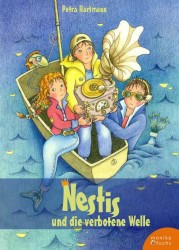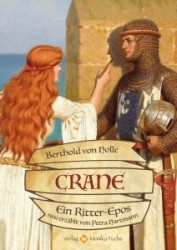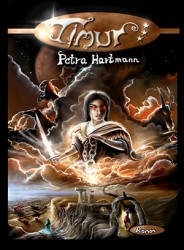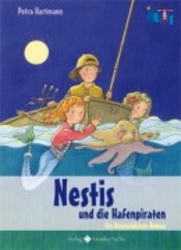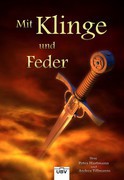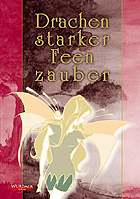Ein weiteres Dokument zur Entstehung meines Romans "Freiheitsschwingen": Es geht um den Schriftsteller Theodor Mundt und seine geplatzte Antrittsvorlesung, die in den "Freiheitsschwingen" eine kleine, aber wichtige Rolle spielt. Meine Heldin ist Augenzeugin, als Mundts Universitätskarriere vor dem Start beendet wird. Hier ein Text, in dem ich die Hintergründe anhand seines Buchs "Madonna" näher untersucht habe.
Vor einigen Jahren habe ich ein paar Vorträge über Zensur zur Zeit des Vormärz und des Jungen Deutschlands gehalten und mich dabei vor allem auf Theodor Mundt und seinen Roman "Madonna" fokussiert. Erstmals habe ich über Mundts "Madonna" im "Literarischen Salon" an der Uni Hannover gesprochen, das war 1991, und ich versuchte damals, meine Kommilitonen für "Die beiden spannendsten Jahre im Leben Theodor Mundts" zu begeistern. Später hielt ich meinen Mundt-Vortrag, jeweils in überarbeiteter Form, zweimal beim Förderverein Rudolf von Bennigsen. Teile davon sind auch in meine Doktorarbeit eingeflosssen, die 2003 unter dem Titel "Von Zukunft trunken und keiner Gegenwart voll" veröffentlicht wurden.
Hier also mein Mundt-Vortrag aus den "Nuller Jahren" in der bislang letzten Form und noch in alter deutscher Rechtschreibung. Viel Vergnügen damit!
"Ich will mir selbst etwas blasen! Jetzt fange ich an, es zu glauben, daß von einer allgemeinen Tonlosigkeit dies unser Zeitalter ergriffen sein muß, denn auch die deutschen Postillons lassen jetzt ihr schmetterndes Mundstück ungenutzt und schläfrig herunterhängen, und jeder sagt mir mißmuthig, ihm sei das Horn verstopft. Auf meiner ganzen Reise durch Deutschland habe ich noch keinen vernünftigen Schwager gehabt, der mir und dem lauschenden Waldecho ein lustiges herzerfrischendes Trarara! Trara! Trara! zum Besten gegeben hätte. Ihnen ist das Horn verstopft. Und ein Postillon ist doch kein deutscher Schriftsteller. Wovor fürchten sich denn die Postillons? Ist es die Censur? Sind es die großen demagogischen Untersuchungen? Mein Gott, ich will mir selbst etwas blasen!"
(Theodor Mundt: Madonna. Unterhaltungen mit einer Heiligen. Leipzig, 1835. S. 1.)
Der junge Mann, der hier so fröhlich auf dem Postwagen sitzt und ins Horn stößt, ahnt nicht, dass diese „Posthornsymphonie“ ihm wenige Monate später seine Universitätskarriere ruinieren wird. Und er weiß auch noch nicht, dass ihn der Deutsche Bundestag für das Buch, aus dem diese Sätze stammen, zum verbotenen Schriftsteller erklären wird, der nie wieder in seinem Leben einen Text veröffentlichen darf.
„Wie bitte?“ werden Sie fragen. „Ein harmloses, etwas überspannt klingendes Trarara vom durch die Lande rumpelnden Postwagen herabgeschmettert - dafür kann man doch nicht verboten werden.“
Aber wir schreiben das Jahr 1835, der Mann mit dem Posthorn ist der Schriftsteller Theodor Mundt, und der deutsche Bundestag hatte zu dieser Zeit nur den Namen mit dem Gremium gemein, das wir heutzutage als Bundestag bezeichnen.
Theodor Mundt hatte geschrieben: „Wovor fürchten sich denn die Postillons? Ist es die Censur?“ Es gab im Jahr 1835 keine harmlosen Sätze, die das Wort „Censur“ enthielten. Der junge Reiseschriftsteller hatte den Namen des Teufels ausgesprochen - und er kam.
*
Theodor Mundt, Jahrgang 1808, wuchs auf in einer Zeit, die wir heute als „Vormärz“ bezeichnen. Also in den Jahrzehnten vor der so genannten Märzrevolution des Jahres 1848, nach der in der Frankfurter Paulskirche erstmals ein frei gewähltes deutsches Parlament zusammentrat. Im Paulskirchenparlament 1848/49 wurden für die Bewohner der deutschen Staaten auch die Grundrechte formuliert. Rechte, wie sie uns heute selbstverständlich vorkommen. Darunter das Recht auf die Gleichheit vor dem Gestz und vor allem das Recht, die eigene Meinung frei zu äußern und sie in Wort und Schrift zu veröffentlichen.
Zu der Zeit, als Theodor Mundts Reiseroman „Madonna“ erschien, konnten die deutschen Schriftsteller und Journalisten von unser heutigen Meinungs- und Pressefreiheit nur träumen. Sie konnten auch von einem Staat namens „Deutschland nur träumen, denn statt eines einheitlichen Staatsgebildes gab es auf der damaligen Landkarte einen bunten Flickenteppich aus knapp 40 mehr oder weniger bedeutenden Kleinstaaten, von denen nur Preußen und Österreich als die beiden größten und vielleicht noch Bayern und Hannover überhaupt ein gewisses außenpolitisches Gewicht hatten.
Fast allen diesen Staaten aber war gemeinsam, dass sie von einem König oder Fürsten mehr oder weniger autoritär regiert wurden und dass der gemeine Mann in der Politik nichts zu melden hatte. Kritik am Herrscher war tabu, Kritik an der Kirche ebenfalls, der Bürger hatte seine Steuern zu zahlen und ansonsten die Klappe zu halten.
Allen diesen kleinen souveränen und zum Teil absolutistisch regierten Ländern war noch etwas weiteres gemeinsam: Sie besaßen eine „Zensurbehörde“. Das war ein Amt, in dem jeder, der etwas drucken lassen wollte, sein Werk vorzuzeigen hatte und um Genehmigung bitten musste.
*
Das Institut der Zensur ist schon sehr alt in den deutschen Ländern. Doch seit 1819 sind die Karlsbader Beschlüsse in Kraft, die den Umgang der Behörde mit Druckerzeugnissen extrem verschärft haben.
Das Amt für Zensur hatte sich auch beileibe nicht nur mit politischen Schriften auseinander zu setzen, die möglicherweise den herrschenden Fürstenhaus unbequem sein könnten. Sondern es ging wirklich um alles, was in die Druckerpresse sollte: Chinesische Grammatiken, Liebesromane, Eintrittsbillets, Fahrkarten, Skatblätter, Speisepläne, Gebrausanweisungen, Fahrpläne, Anatomische Lehrbücher, gedruckte Einladungen oder Glückwunschkarten, Lyrikbände, Homerübersetzungen, Bastelbögen, Reiseführer, Lexika, Adressenverzeichnisse, Stadtpläne ... Und der Beamte nahm dann seinen Rotstift und strich alles irgendwie missliebige aus. Im Druck standen dann meist an den Stellen Gedankenstriche.
Gestrichen wurden dabei: Politisch anstößiges, Erotisches, kritische Bemerkungen über die Kirche oder die Religion, persönliche Beleidigungen und meistens auch alle Äußerungen über die Einrichtung der Zensur selbst.
Wozu das alles? Nun, seit der Französischen Revolution von 1789 ging die Angst um unter den Herrschern. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass das Volk auf die Idee kam zu rebellieren. Und gerade erst - im Jahr 1832 - hatte es im Nachbarland Frankreich mit der Julirevolution eine Neuauflage von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gegeben. Die Regierungen waren also hypernervös, die Zensoren in Alarmstimmung, und die jungen Schriftsteller freiheitsbegeistert und ständig dabei, ihre Grenzen auszutesten.
Ein Schlupfloch gab es, der Vorzensur zu entkommen: Von der Pflicht, sein Buch dem Zensor vorzulegen, war der Auto entbunden, wenn seine Schrift mehr als 20 Druckbogen umfasste. Ein Druckbogen sind 16 Seiten. Wer also ein Buch mit mehr als 320 Seiten schrieb, der konnte darin zunächst einmal alles sagen, was er wollte. Er durfte über Freiheit schreiben, über Wahlrecht, über die Gleichberechtigung der Frauen und Juden, über die Verschwendungssucht seines Landesherrn, über ungerechte Gesetze, über Sex, es war der Behörde egal. Jenseits der 320-Seiten-Schallmauer lag die große Meinungsfreiheit.
„Man verbietet, mit Schrot zu schießen, aber man erlaubt das Schießen mit Kanonen“, spottete der Journalist und Schriftsteller Ludwig Börne. Aber aus der Sicht der Behörden war diese Regel durchaus sinnvoll und logisch.
Ein Flugblatt war gefährlich. Ein dünnes politisches Programm. Eine kleine Kampfschrift gegen eine neue Steuer. Da kann es schnell passieren, dass die Volksseele überkocht, und plötzlich finden sich ein paar Weber, Bauern und Fischhändlerinnen zusammen und spielen Französische Revolution. Aber, du liebe Zeit, wer liest denn schon 320 Seiten dicke Bücher? Ein paar verstaubte Professoren und Studierstubengelehrte, die sitzen dann einsam sechs Treppen hoch in ihrer einsamen Spitzweg-Dachkammer, und wenn sie nach der Lektüre des Buches ganz doll erregt sind, dann setzen sie sich hin und schreiben ein neues Buch, das erscheint dann ein bis zwei Jahre später und hat ebenfalls mehr als 320 Seiten. Aber von solchen harmlosen, weltfremden Spinnern macht natürlich niemand eine Revolution. Gefährlich war allein die Masse. Und deren Lektüre wurde kontrolliert. Das hat seit 1819 auch recht gut funktioniert.
Bis zu dem Zeitpunkt, als eine neue Dichtergeneration die Augen aufschlug. Heinrich Heine stieg am Literaturhimmel auf, in Frankfurt machte der Journalist Ludwig Börne von sich reden. Karl Gutzkow, Heinrich Laube, Ludolf Wienbarg und Theodor Mundt, die man später in Literaturgeschichten unter dem Namen „Das junge Deutschland“ zusammenfassen wird, machten eine Entdeckung: Sie fanden heraus, wie man auch ganz normale und weniger gebildete, also weniger kleidensfähige Leser über 320 Seiten bei der Stange hält.
Sie entwickelten einen völlig neuen Schreibstil, spickten ihre Texte mit Wortspielen, kühnen Metaphern und witzigen Anekdoten, schoben zwischenzwei kurzen politischen Absätzen mal eben eine fast pornografische Liebesszene ein und - was die Behörden bis zur Weißglut reizte - sie begannen, mit der Zensur zu spielen.
Plötzlich ist es nicht mehr nur ein pflichtbewusster Beamter, der Wörter und Sätze ausstreicht. Plötzlich setzen die Autoren selbst an den spannendsten Stellen ihre eigenen schwarzen Zensurlücken-Gedankenstriche und nehmen die Arbeit der Behörde ironisch vorweg. Einen der einprägsamsten Texte über das Thema Literaturzensur hat Heinrich Heine im 12. Kapitel von „Ideen. Das Buch le Grand“ geschrieben:
Die deutschen Zensoren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dummköpfe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Ludwig Börne, der seine Kritik an den politischen Zuständen in Theaterkritiken zwischen den Zeilen ins Publikum schmuggelte, oder doppeldeutige Buchbesprechungen verfasste, schrieb in einer Rezension eines politischen Buches zum Beispiel frech: „Dass dieses Buch gut ist, kann ich leichter behaupten als beweisen. Denn das Buch hat mehr als 20 Bogen - und meine Zeitschrift weniger."
Können Sie sich einen triumphierenderen Titel vorstellen als den Namen, den Georg Herwegh für eine Aufsatzsammlung fand: „21 Bogen aus der Schweiz“? Mehr Freiheit auf einem Buchdeckel anzukündigen ist eigentlich kaum möglich.
*
Als Theodor Mundt Anfang im Sommer 1835 seinen Roman „Madonna. Unterhaltungen mit einer Heiligen“ veröffentlichte, waren die Behörden bereits extrem gereizt. Sie witterten ein Komplott der Schriftsteller. Und der junge Theodor Mundt, der bereits durch einige politische Schriften von sich reden gemacht hatte, was ein Autor, auf den sie ein besonderes Augenmerk gerichtet hatten.
Mundts Buch ist 436 Seiten dick, musste also vor dem Druck nicht durch die Zensur. Aber was genau ist das eigentlich für ein Buch, und mit welcher Technik hält Mundt seine Leser wach?
Modern gesprochen betreibt Mundt „Literarisches Zapping“. Der äußere Rahmen ist eine Reisebeschreibung. Ein namentlich nicht genannter Ich-Erzähler ist unterwegs nach Prag und schildert seine Reiseeindrücke. Die Reisebeschreibung war ein beliebtes Genre der jungdeutschen Schriftsteller. Schließlich kann man unterwegs über Gott und die Welt plaudern und so ziemlich jedes Thema anschneiden. Und so ist auch Mundts Buch eher ein Literatur-Mix. Es finden sich darin eine Liebesgeschichte, mehrere Briefe mit Kunstschilderungen und Geschichtstheorien, eine historische Novelle, Angriffe auf Kirche, Adel und auf eine verklemmte Sexualmoral, ein Loblied auf Casanova und eine Literaturtheorie des „Nicht-Romans“.
Im Nachwort schreibt Mundt daher mit gespielt biederer Philologenverzweiflung:
"Und ihr Richter, wie wollt ihr dies Buch taufen, da es doch nun einmal ein christlich erzeugtes Buch ist, und als solches, wie jedes gute Kind, Namen und Taufe zu erhalten verdient? Wollt ihr ihm die Nothtaufe eines Romans geben, es mit dem Unschuldsnamen der Novelle benennen? Helft mir bei Zeiten aus dieser Verlegenheit da der Setzer stündlich auf das Titelblatt wartet! Oder besser, wir zerbrechen uns lieber alle durchaus nicht den Kopf damit. Ich erkläre mit feierlicher Resignation, daß es eigentlich gar kein Buch ist, das ich herausgebe, sondern bloß ein, Stück Leben, das sich, wie Schlangenhäutung, auf diesen zerstreuten Blättern abgelöst hat. Macht also nicht so viele Umstände mit einem Stück Leben! Seht zu, ob ihr es brauchen könnt, ob nicht, und taugt es euch zu keinem Dinge, so laßt es laufen, wie einen jungen Menschen, mit dem sich vor der Hand noch nichts Solides anfangen läßt. Laßt es laufen, laßt es laufen! Es läuft gern, denn es liebt die Bewegung!
Ja, wollt ihr ihm durchaus einen Büchernamen geben, so nennt es ein Buch der Bewegung! Nicht bloß, weil es der vagabundirende Verfasser auf Reisen geschrieben hat, sondern weil wirklich alle Schriften, die unter der Atmosphäre dieser Zeit geboren werden, wie Reisebücher, Wanderbücher, Bewegungsbücher aussehen. Die neueste Aesthetik wird sich daher gewöhnen müssen, diesen Terminus ordentlich in Form Rechtens in ihre Theorieen und Systeme aufzunehmen. Die Zeit befindet sich auf Reisen, sie hat große Wanderungen vor, und holt aus, als wollte sie noch unermeßliche Berge überschreiten, ehe sie wieder Hütten bauen wird in der Ruhe eines glücklichen Thals. Noch gar nicht absehen lassen sich die Schritte ihrer befriedigungslosen Bewegung, wohin sie dieselben endlich tragen wird, und wir Alle setzen unser Leben ein an ihre Bewegung, die von Zukunft trunken scheint. Und daher das Unvollendete dieser Bewegungsbücher, weil sie noch bloß von Zukunft trunken sind, und keiner Gegenwart voll!"
(Theodor Mundt: Madonna. S. 433f)
*
Werfen wir noch einige weitere in das Buch „Madonna“. Das Eingangskapitel, die „Posthornsymphonie“ hatten wir bereits gestreift. Es folgt eine Beschreibung des böhmischen Landes, allerdings unter der Maßgabe: „Schöne Gegenden werde ich nie beschreiben - die Zeit und ich, wir sind zu unruhig dazu.“
Es soll um Menschen gehen, um Politik, Geschichte und Lebensphilosophie. Daher ist auch anlässlich eines Besuches auf dem Schloss Dux eine lange Laudatio auf Casanova und seine Lebensweise eingefügt, die allein schon jedem Zensor die Schamesröte in die Bleistiftspitze treiben konnte. Und dann, endlich, begegnen wir der Titelfigur, dem böhmischen Mädchen Maria, vom Reiseschriftsteller als eine „weltliche Heilige“ bezeichnet.
Maria ist fromm, sehr fromm. Aber zugleich auch voller Weltliebe. Von ihrem Vater, einem bigotten alten Schulmeister unterdrückt und an religiöse Formen gefesselt, versauert sie hinter den böhmischen Bergen und träumt von der Welt. Maria und der Reiseschriftsteller schließen, da sie sich von Anfang an als verwandte Seelen erkennen, einen Pakt. Der Schriftsteller schreibt ihr Briefe von seinen Fahrten, und Maria bittet ihn ausdrücklich darum, ihr von der Welt zu schreiben und ihr auch die verbotenen Stellen darin mit sympathetischer Tinte zu zeichnen.
Hier mal eine der „verbotenen Stellen“, Mundt spielt mit der Betonung des Wortes "Damals“:
"Denn diese Mächte [Preußen und Österreich, P.H.] hatten schon nach der Schlacht bei Culm am 30. August 1813 ihre Hauptquartiere nacht Teplitz verlegt, um es für die vielen Bedrängnisse, welche diese Stadt erlitten, zu entschädigen, und unterzeichneten im September desselben Jahres jene Allianz-Tractate, die damals für die Befreiung Deutschlands von so großen Folgen wurden. Und ich bin wahrhaftig unschuldig daran, wenn hier jemand einfallen sollte, den Ton auf Damals zu legen. Was in aller Welt geht mich die Betonung meiner Sätze an. In diesem accentlosen deutschen Leben habe ich längst den Muth verloren, auf die rechte Stelle den Ton zu setzen, wo ich wohl möchte. Die Lehre, mit Accent und Nachdruck zu sprechen, ist eine gefährliche Wissenschaft, und sie wird Einem abgewöhnt in der Spießbürgerprosa unserer Redefreiheit. Ein mattes Leben, seine Aussprache ohne Accente! Da kann kein Schulmeister helfen!"
(Madonna, S. 154f)
Maria schickt ihm im Gegenzug ihre Lebensgeschichte. Und während sie von ihm aus Prag drei Briefe mit dem zensorenalarmierenden Titel „Katholizismus, Legitimität, Wiedereinsetzung des Fleisches“ erhält, schickt sie ihm im Tausch die „Bekenntnisse einer weltlichen Seele“.
"So wenig hat wohl nie ein Kind von sich selbst gewußt, als ich bis in mein neuntes Jahr. Frühere Erinnerungen sind mir fast gar nicht übrig geblieben, und nur eines einzigen bestimmten Gefühls erinnere ich mich sehr deutlich. Dies war, daß mich Vater und Mutter gar nicht liebten, und mir nie ein Vergnügen machten. Und noch eine Aeußerung ist mir im Gedächtniß geblieben, denn welches Mädchen würde so etwas nicht behalten? Nämlich, daß einst der Pfarrer uneres Orts sagte, er habe noch nie ein Kind so hübsch lachen gesehn, wie mich. Es ist seltsam, daß manches Wort, das wir als Kind in der ungewissen Dämmerung unserer Sinne nur wie aus weiter Ferne über uns hören, wie ein Blitz in uns einschlägt, und, ich glaube, noch auf dem Sterbebette uns wieder einfallen kann. Diese Aeußerung, daß ich hübsch lachen konnte, habe ich nie vergessen. Ich muß also doch schon auf meine eigene Hand viel gelacht haben, ungeachtet mir meine harten Eltern nie Vergnügen machten. Aber der freundliche Pfarrherr schenkte mir auch ein Rothkehlchen, das ich sehr lieb hatte, mit dem ich viel sprach und mich freute. Es durfte auch nicht oft aus der Stube gehen, sowie ich, und mußte sich in seinen jungen Tagen damit abgeben, Fliegen zu fangen, sowie ich Sorgen. Ich half ihm redlich Fliegen fangen, und es half mir seinerseits, durch seine possirlichen Sprünge, über die ich herzlich lachen mußte, mir die Sorgen zu verscheuchen. Nur die Dummheit konnte ich ihm nie vergeben, daß er sich die Flügel hatte stutzen lassen, und wenn ich ihn mir auf die Hand stellte, und ihn vor mir aufrichtete, setzte ich ihn ordentlich deshalb zur Rede. Hätte ich Flügel, dachte ich, nie sollten sie mir die stutzen. Ich flöge gerade mitten ins Leben hinein, über alle die finstern böhmischen Berge hinweg, hinter denen ich geboren bin. Aber das Rothkehlchen wetzte sich den Schnabel, und schien sich mit seinen grellen närrischen Augen über mich lustig zu machen.
Ich hatte, ich weiß nicht mehr wo, etwas vom Leben gehört oder in meiner Bilderfibel gelesen, denn ich konnte schon lesen. Ich stellte mir unter diesem räthselhaften Worte etwas vor, das weder in meinem böhmischen Dorfe zu Hause ist, noch von dem Vater oder Mutter eine Ahnung hätten. Etwas ganz außerordentlich Liebreiches und Angenehmes, das hinter den Bergen zu haben wäre. Nie ging ich ins Bett, ohne beim Abendgebet daran zu denken, und jedesmal bat ich den lieben Gott von ganzem Herzen um Leben. So that ich in meinem thörichten Sinn auch beim Morgengebet. Mein Vater durfte nichts davon wissen, weil er mich sonst geschlagen hätte. Freilich wußte ich auch selbst nicht, um was ich bat, aber es war mir doch unbeschreiblich süß, immer auf ein so ahnungsvolles Wort meine Hoffnung zu setzen. Es war wie eine geheime Liebschaft, welche die Kinderseele mit der Zukunft führte, und oft jauchzte es in mir auf, wenn ich mir lebhaft vorstellte, was Alles hinter den Bergen sein müsse. Entweder hinter dem großen Milleschauer oder dem ernsten Erzgebirge dachte ich mir das Leben verborgen. Ich stand oft stundenlang, und wartete ab, bis die Sonnenscheibe hinter diesen Berggipfeln untersank.
So stand ich auch einstmals am Fenster, als ich plötzlich hinter mir die Worte hörte, daß ich nach Dresden solle. Ich sah mich erschrocken um, und die Thränen stürzten mir vor Ueberraschung aus den Augen. Der Vater hatte einen Brief in der Hand, und die Mutter sah ihm, mit lang vorgestrecktem Hals, lesend über die Schulter. Endlich erfuhr ich, daß eine reiche Tante in Dresden mich als ihr Kind anzunehmen wünsche, und daß sich nichts Vortheilhafteres für mein Glück finden lassen könne. Ich hörte zum ersten Mal etwas von Dresden, und fragte, indem alle Sehnsucht in mir losbrach, ob es hinter dem Milleschauer liege, wo auch das Leben sei? Dann wolle ich mit Freuden hingehn. Ich wurde über meinen Vorwitz ausgescholten, und nur die Mutter, die etwas milder war, lächelte, und nahm mich auf den Schooß, und machte mir die Zöpfchen zurecht, damit ich hübsch aussähe, wann ich nach Dresden käme. Der Vater ging aus dem Zimmer, um seine Schulstunden abzuhalten, und sagte kein Wort. Ich ließ mir doch im Stillen die Hoffnung nicht nehmen, daß ich in Dresden das Leben finden würde." (Madonna, S. 188ff)
*
War die „Madonna“ ein gefährliches Buch? Auf uns heutige wirken die politischen Forderungen wie banale Selbstverständlichkeiten, und die damals als frivol und schlüpfrig empfundenen Szenen könnte man locker im Kinderprogramm der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten senden.
Damals war das anders. Das verrät ein Blick auf die Folgen des Buches. Mundt, der Philosophie studiert und im Jahr 1830 seinen Doktortitel mit einer Arbeit über die Redekunst im antiken Sizilien erworben hatte, wollte eigentlich als Professor an die Universität gehen. In Berlin hatte er bereits Vorlesungen gehalten. Im Jahr 1834 hatte er sich für eine Professur beworben. Er hatte einflussreiche Fürsprecher wie zum Beispiel den Kultusminister von Altenstein. Im Juni 1835 war sein Habilitationsverfahren bereits so gut wie abgeschlossen, und alle Professoren bescheinigten ihm eine „geistreiche Auffassung, lebhafte, aufregende Darstellung und fleißiges Eindringen in den Stoff.“ Bereits im Sommersemester wollte Mundt seine Lehrtätigkeit aufnehmen. Einzig die Antrittsvorlesung stand noch aus und wurde von allen Beteiligten als eine reine Formsache betrachtet ...
Aber am Morgen vor dieser Vorlesung lagen plötzlich Auszüge aus der gerade erschienenen „Madonna“ auf dem Schreibtisch von Universitätsrecktor Heinrich Steffens. Mundts Denunziant hatte dem Rektor hilfsbereit sogar die gefährlichsten Stellen herausgeschrieben. Und Steffens, der es mit der Angst zu tun bekam, ließ in der ersten Panik die Aula der Universität sperren und vertagte die Veranstaltung auf unbestimmte Zeit.
Ich stelle mir die Geschichte immer so vor wie in der Feuerzangenbowle: Studenten scharen sich vor dem Tor, lesen auf einem Schild: „Wegen der Bauarbeiten ist die Aula heute geschlossen“ und gehen achselzuckend wieder weg.
Das Buch wird vom Preußischen Oberzensurkollegium nachträglich verboten. Das war gängige Praxis im Umgang mit Büchern, die die Vorzensur umgangen hatten. Damit konnten Mundt und seine Kollegen und Verleger rechnen. Aber dann passierte etwas, womit Mundt nicht rechnen konnte:
In Stuttgart begann der damalige Literaturpapst Wolfgang Menzel einen Feldzug gegen die „Junge Literatur“. Er warf den bekannteren Autoren der jungen Generation vor, sie seien gottlos und verderben die Jugend. Das war fast wörtlich die Anklage, mit der man in Athen Sokrates zum Tode verurteilt hatte.
Menzels Hauptgegner ist Karl Gutzkow, der zeitgleich mit Mundt seinen Roman „Wally die Zweiflerin“ veröffentlicht hatte. Auch dieses Buch ist ein Gemisch aus Briefen, politischen und theologischen Essays, Novellen und einer Liebesgeschichte. Die „Wally“ erregte einen Literaturskandal, da in einem Kapitel die Titelheldin sich ihrem Geliebten nackt zeigt.
Menzels monatelange Hasstiraden in Zeitungen gegen Gutzkow und seine angeblichen Spießgesellen zeigen langsam Wirkung. Schließlich ergreift Metternich die Initiative. Der österreichische Kanzler ist zu dieser Zeit der einflussreichste Politiker in allen deutschen Staaten. Als der Bundestag - die Versammlung der Abgesandten aller deutschen Landesfürsten - am 10. Dezember 1835 tagt, beschließen die Abgeordneten, reinen Tisch zu machen. Sie verbieten die Autoren Theodor Mundt, Karl Gutzkow, Heinrich Laube und Ludolf Wienbarg - und weil man gerade so schön dabei ist, kann man im gleichen Atemzug auch mit dem ungeliebten Heinrich Heine abrechnen.
Verboten werden in allen deutschen Staaten alle Werke dieser fünf Autoren und - das ist bisher noch nie vorgekommen - auch alle ihre zukünftigen Werke. Für einen Berufsschriftsteller, der von den Werken seiner Feder leben muss, bedeutet dies das absolute Aus.
Heinrich Laube und Karl Gutzkow haben zusätzlich Gefängnisstrafen zu verbüßen. Wienbarg flüchtet in seine Heimatstadt Altona, die damals noch unter dänischer Herrschaft stand. Er kommt mehr und mehr herunter, ergibt sich schließlich dem Alkohol, verliert am Ende den Verstand und vegetiert die letzten zehn Jahre seines Lebens in einer Irrenanstalt dahin.
Theodor Mundt ist bei dem allen noch am glimpflichsten davongekommen, er ging zunächst auf Reisen nach Frankreich, England und in die Schweiz. Nach einiger Zeit wurden die Verbotsbestimmungen dann auch tatsächlich etwas gelockert. Die Autoren konnten unter verschärfter Spezialzensur wieder veröffentlichen, aber es war vorbei mit der Herrlichkeit des Jungen Deutschlands. Ein Buch wie die Madonna hat Mundt nie wieder schaffen können.
Mehr zum Hintergrund der "Freiheitsschwingen":
Das Hambacher Fest
© Petra Hartmann



 Benutzerdefiniertes Design erstellen
Benutzerdefiniertes Design erstellen