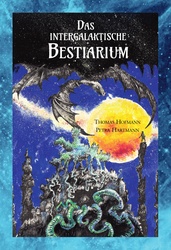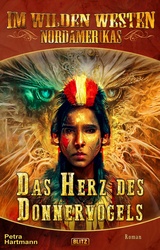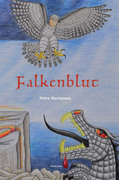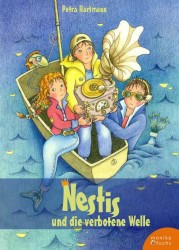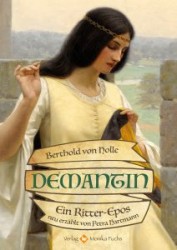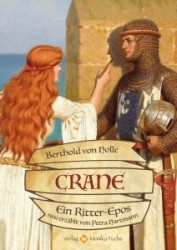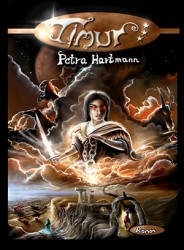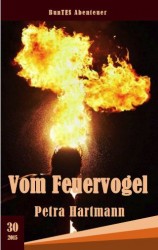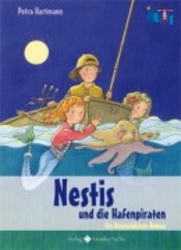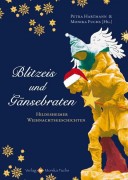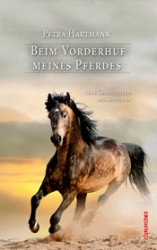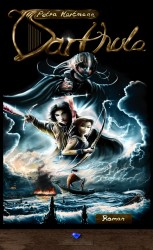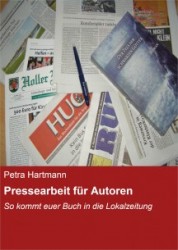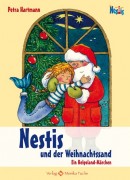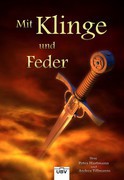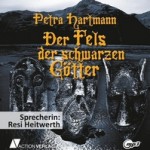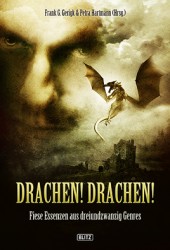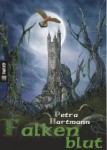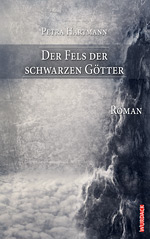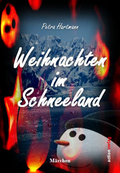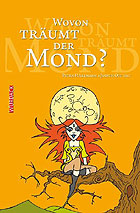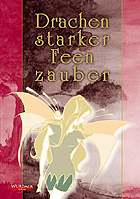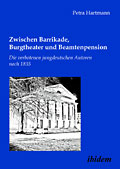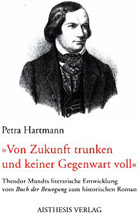Den Krieg übersetzen. Gedichte aus der Ukraine
Lyrik Ukraine
Wie fasst man den Krieg in Worte, in Lyrik gar? Wie beschreibt man das namenlose Grauen, den Alltag in bombardierten Städten im Gedicht? Und wie transportiert man diese Verse dann auch noch aus dem Ukrainischen ins Deutsche?
16 Lyriker und Lyrikerinnen aus der Ukraine haben ihre Kriegserfahrungen in Worte gegossen. "Den Krieg übersetzen" lautet der Titel dieser Anthologie. Und ob und wie man den Krieg - oder zumindest diese Gedichte - tatsächlich übersetzen kann, das ist eine Frage, der dieses Buch nachgeht. In drei Vorworten denken die drei Herausgeber darüber nach, was das eigentlich bedeutet: "Den Krieg übersetzen", "Im Krieg übersetzen", "Vom Krieg lesen".
16 Autoren haben Gedichte zu diesem Band beigesteuert. Nur 15 erlebten das Erscheinen des Buches. Victoria Amelina starb an den schweren Verletzungen, die sie durch einen russischen Raketenangriff erlitten hatte. "Luftalarm im ganzen Land", hatte sie in einem Gedicht geschrieben, das den Band eröffnet,
Als führe man alle gleichzeitig
Zur Erschießung
Und zielte doch nur auf einen
Meistens den am Rande
Heute bist das nicht du, Entwarnung"
Das hatte sie am 5. April 2022 geschrieben. Am 1. Juli 2023 war sie es dann doch gewesen. Kriegsschicksal.
Tatsächlich geht es in vielen der Gedichte um Sprache und um die Unmöglichkeit, die Erlebnisse in Worte zu fassen. "Gesplitterte Sprache / klingt nach Lyrik / ist aber keine", schreibt Amelina. Ihre Kollegin Daryna Gladun ist unter den Autoren dieses Bandes diejenige, die die Sprachlosigkeit am drastischsten, nämlich auch optisch, thematisiert. Lange schwarze Balken wie Schwärzungen in Stasi-Akten tauchen in ihren Gedichten auf. Wobei einige davon nicht unkenntlich gemachte Passagen in Protokollen symbolisieren, sondern ein Fließband, an dem einfache, vielleicht kriegsdienliche, Arbeiten verrichtet werden, die keinen Geist verlangen. Senkrechte Striche |||||||||||||||| füllen ganze Verse und Strophen. Gedankenstriche -------------- wirken wie Zensurlücken oder wie Kennzeichnungen für verlorene Wörter und Buchstaben aus antiken Papyri. Und im Gedicht "Institut zur Revision der Geschichte" ist immer wieder der Platzhalter "[x-beliebige Phrase]" eingefügt. Die Sprache des Krieges, in der Zahlen von Toten nicht veröffentlicht und Verluste beschwiegen werden. Die Sprache der Angegriffenen, die die Zähne zusammenbeißen und nicht klagen.
"es gibt Leichen
und keine Worte keine gar keine Worte
nur herumliegende Leichen",
heißt es in "#BuchaMassacre" von Ella Jewtuschenko, das furchtbare Kriegsverbrechen und der Massenmord ist wie ein Hashtag in den sozialen Medien markiert. "Die Dichtung ist tot ermordet in Butscha". Kann man nach Auschwitz noch Gedichte schreiben? Kann man nach Butscha noch Gedichte schreiben? Es gibt Dinge, über die man nicht reden kann. Denn
"was sollen schon Worte
gegen die rohe Gewalt
gegen ihren Hass
einen Hass
den nicht mal Wildtiere kennen"
Und Oleh Kadanov stellt fest: "die worte sind uns ausgegangen / es ist zeit neue zu erfinden". Doch woher sollen die Worte kommen, wenn der Krieg allgegenwärtig ist? Da wird Sprache eher zum "Helfer-Flüchtlings-Chat" und schöne Metaphern zum "Zerrspiegel Literatur" (Iya Kiva).
Grundsätzlich ist das die Botschaft aller dieser Gedichte: Der Krieg ist allgegenwärtig, er dringt durch alle Türen, Fenster, Wände ins Haus. Ob du Radio hörst oder Zeitung liest, ob du ein Mittagessen kochst oder deine Kinder zu Bett bringst, du tust es immer im Krieg. Einkaufen und Frühstücken, Naturszenen, Freunde treffen, Abschiednehmen, Tod oder Liebe, es gibt keinen Aspekt des Lebens, der nicht berührt wäre vom und bezogen auf den Krieg. Wer mit Freunden im Ausland telefoniert oder Mails verschickt, muss erklären, wie es ihm geht. Wer an andere Länder denkt, denkt automatisch mit: Auch dort ist es nicht sicher. "Den Krieg wirst du immer in dir daheim, im Exil, selbst in diesem Flugzeug tragen", notiert Jurij Bondartschuk.
Gebete werden gesprochen, transformiert, persifliert, gerichtet an einen Gott, der weder existiert noch zuhört. Ein Liebeslied im Krieg hört sich so an:
"Wenn der Frühling anbricht und uns Wärme beschert,
will ich dir Blumen bringen,
doch zuerst muss unsere Luftabwehr
die Feindesraketen bezwingen"
Der Verfasser Pawlo Korobtschuk hält fest:
"Ich kann nicht sprechen, will nicht sprechen,
denn die Wörter leben weiter,
die von russischem Pack Ermordeten aber nicht."
Da will er gern Wörter gegen Menschen tauschen, Wörter aufgeben und die Ermordeten dafür zurückbekommen. "Denn wozu brauchen wir Wörter, / wenn es niemanden gibt, dem man sie sagt."
Ein wenig an Celans Todesfuge erinnern Zeilen aus einem titellosen Gedicht von Olena Stepanenko, in dem die Söhne aufgefordert werden, die Trommeln des Krieges fester zu schlagen, auch wenn es der Grabstein der Dichterin werden sollte. Darin heißt es:
"hass
verzweiflung
böse und fröhliche rage
wir essen sie morgens
wir schlingen sie mittags
wir würgen sie hinunter am Abend"
Ganz ähnlich Daryna Gladun in "die botschafter des krieges", sie schreibt:
"wir wickeln uns in eine decke aus krieg
wir machen kriegsdiät
wir essen ihn morgens
wir essen ihn mittags wir essen ihn abends"
16 Stimmen, aber doch nur eine: Es ist der Krieg, der aus diesen Zeilen spricht. Der Krieg der alles berührt, alles beschmutzt, jede, aber auch jede Tätigkeit in Besitz nimmt, jeden Gedanken. Insofern ist diese sehr vielseitige Sammlung doch wieder nur auf den einen einzigen Ton gestimmt: Es ist Krieg, und wohin wir auch gehen, er ist bei uns und wird immer bei uns bleiben.
Die Autoren sind ausnahmslos hochklassige Schriftsteller. Die Gedichte gehen in ihrer Qualität weit über Betroffenheitslyrik aus Therapiegruppen hinaus. Es ist sehr schade, dass solche großartigen Dichter sich an ein so widerliches Thema wie Krieg verschwenden müssen. Und doch ist es gut, dass gerade sie der alltäglichen Kriegserfahrung Stimme und Gesicht geben. Diese Gedichte berühren, sie machen das Unfassbare wenn nicht fassbar so doch erahnbar, sie tragen Gefühle und Gedanken über Länder, Grenzen und Sprachgrenzen hinweg.
Es wäre ihnen allen, beziehungsweise den 15 der 16 noch lebenden Autoren zu wünschen, dass sie eines Tages wieder einfach nur über Liebe, Natur und ihre Mitmenschen schreiben können. Doch ob dieser Krieg je wieder aus ihren Gedanken und Werken verschwinden wird, bleibt fraglich.
Fazit: Verse über die Allgegenwart des Krieges, Banalitäten und Bombenhagel, Liebeslieder und Gebete und die Suche nach der Sprache. Eine berührende Sammlung, nicht unbedingt schön, aber groß und wichtig. Lesenswert.
Der Krieg übersetzen. Gedichte aus der Ukraine. Hrsg. v. Claudia Dathe, Tania Rodionova und Asmus Trautsch. Berlin: edition.foto.TAPETA, 2024. 190 S., Euro 17,50.
© Petra Hartmann


 Benutzerdefiniertes Design erstellen
Benutzerdefiniertes Design erstellen